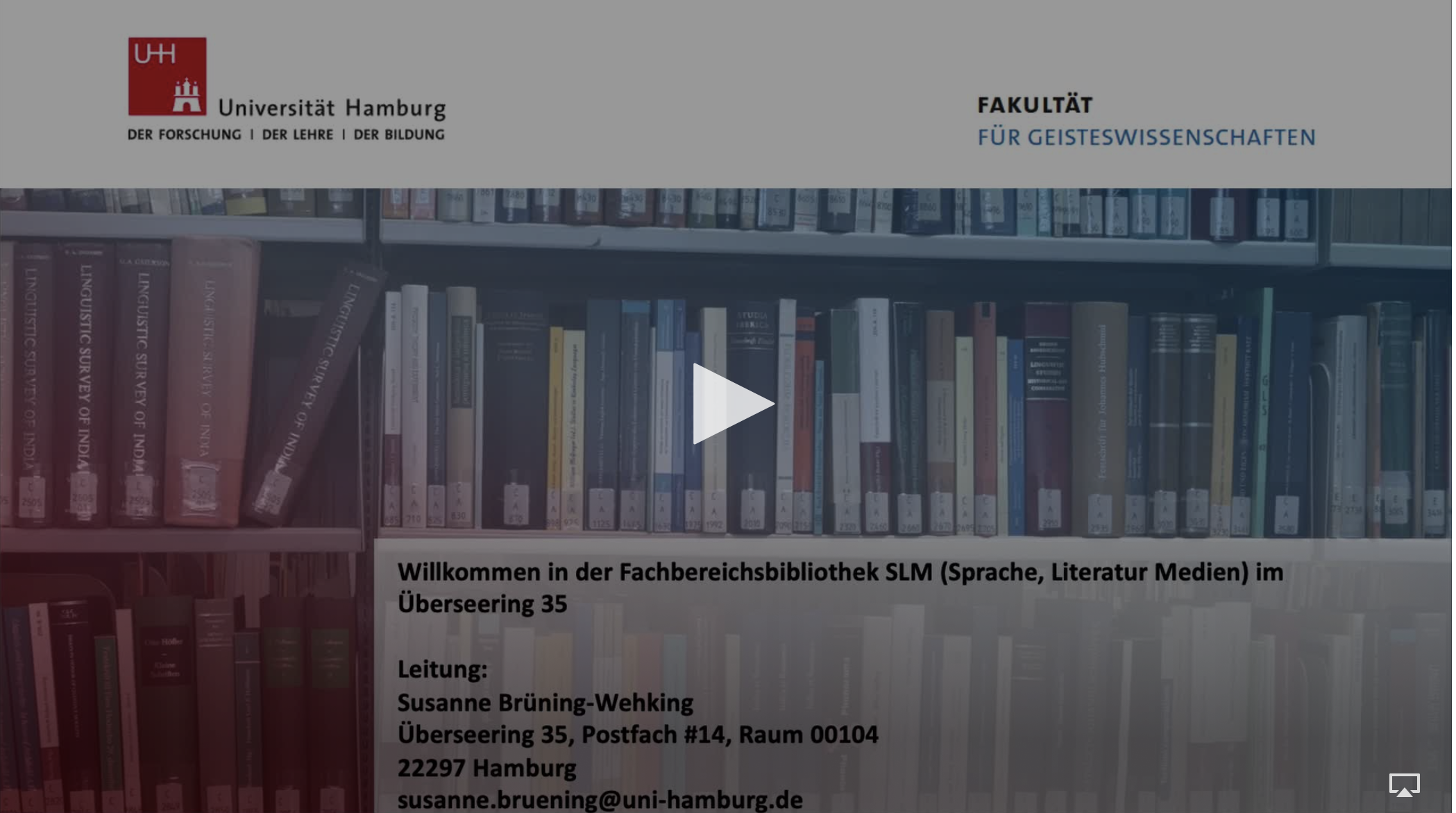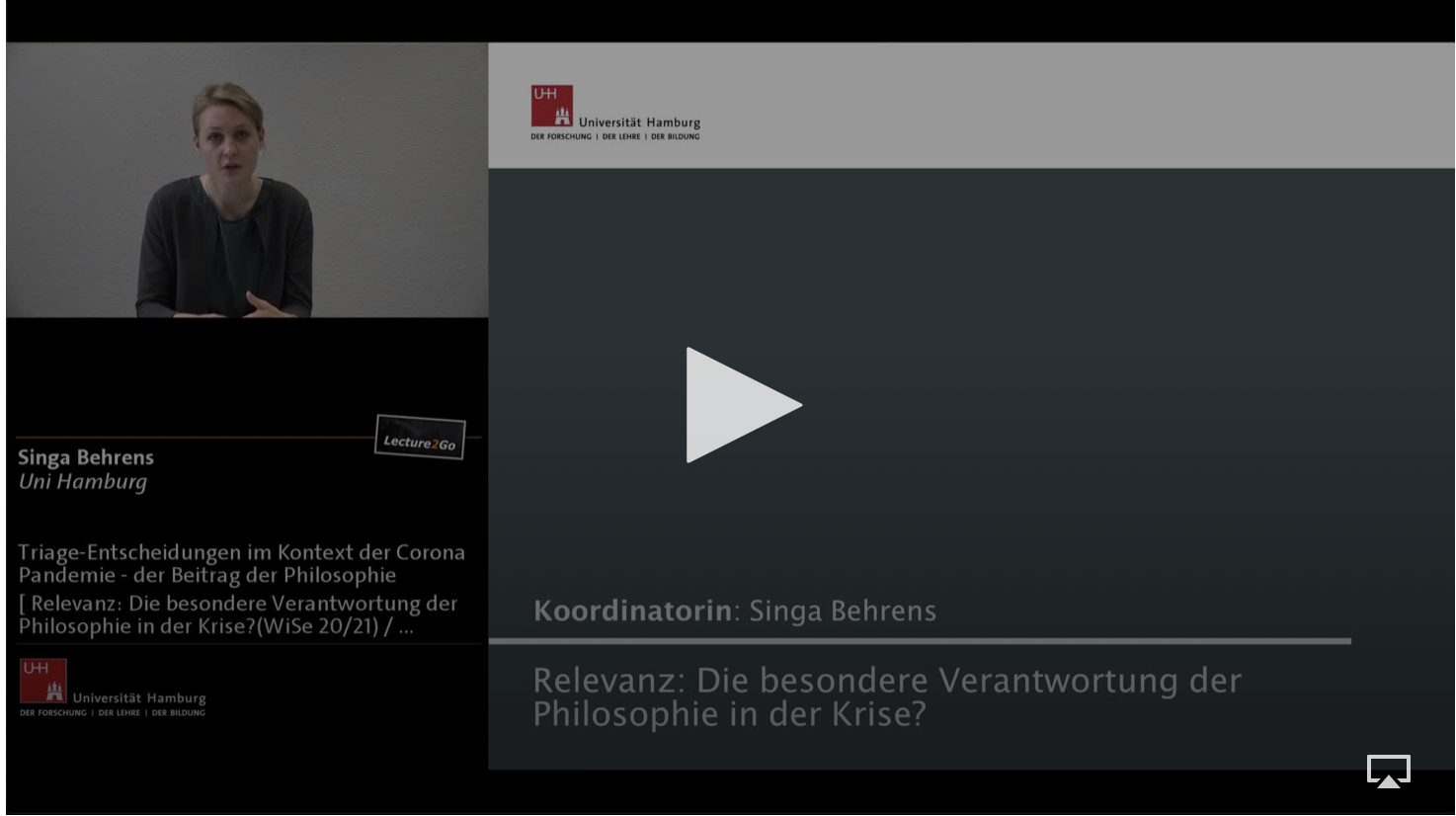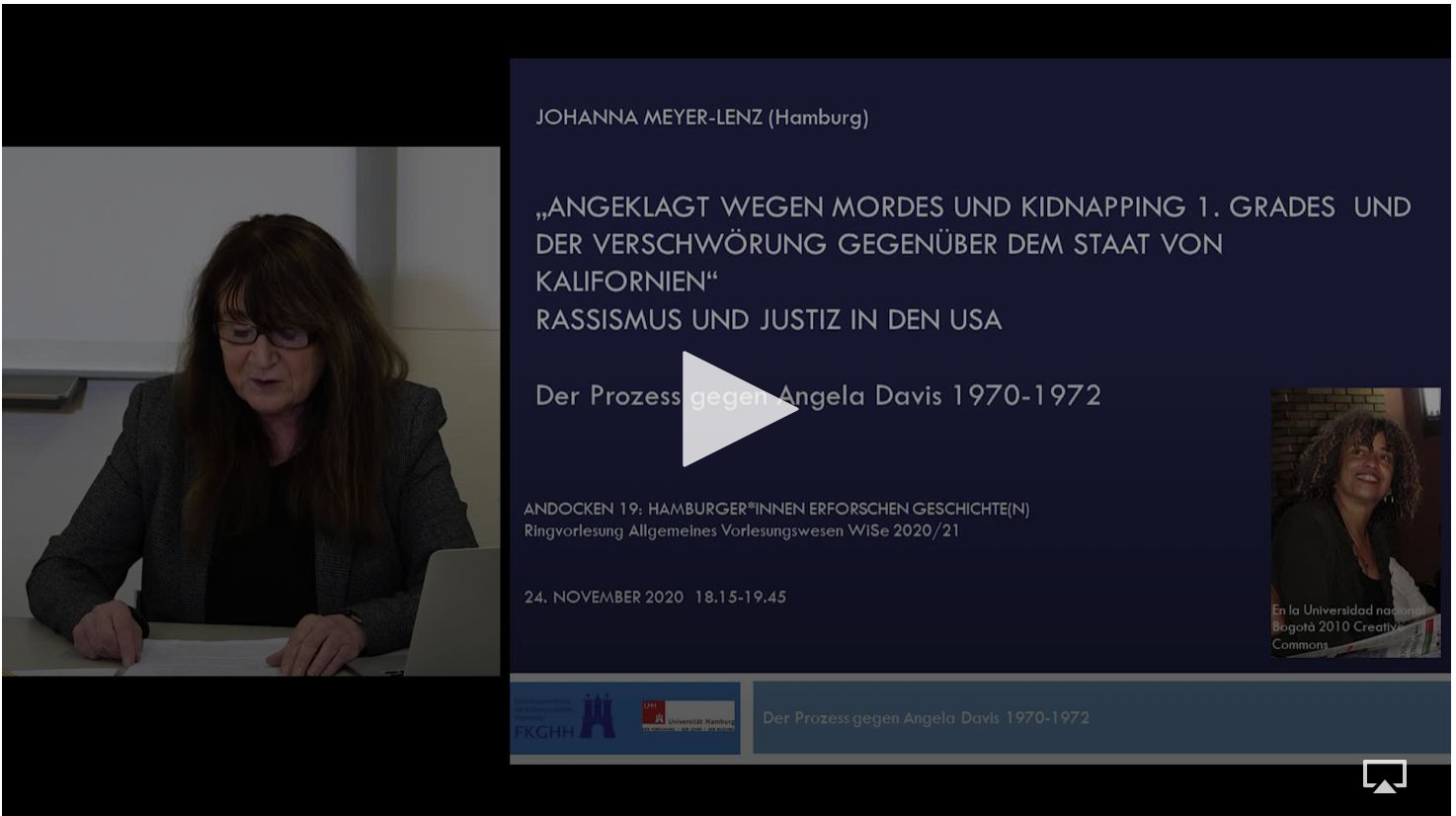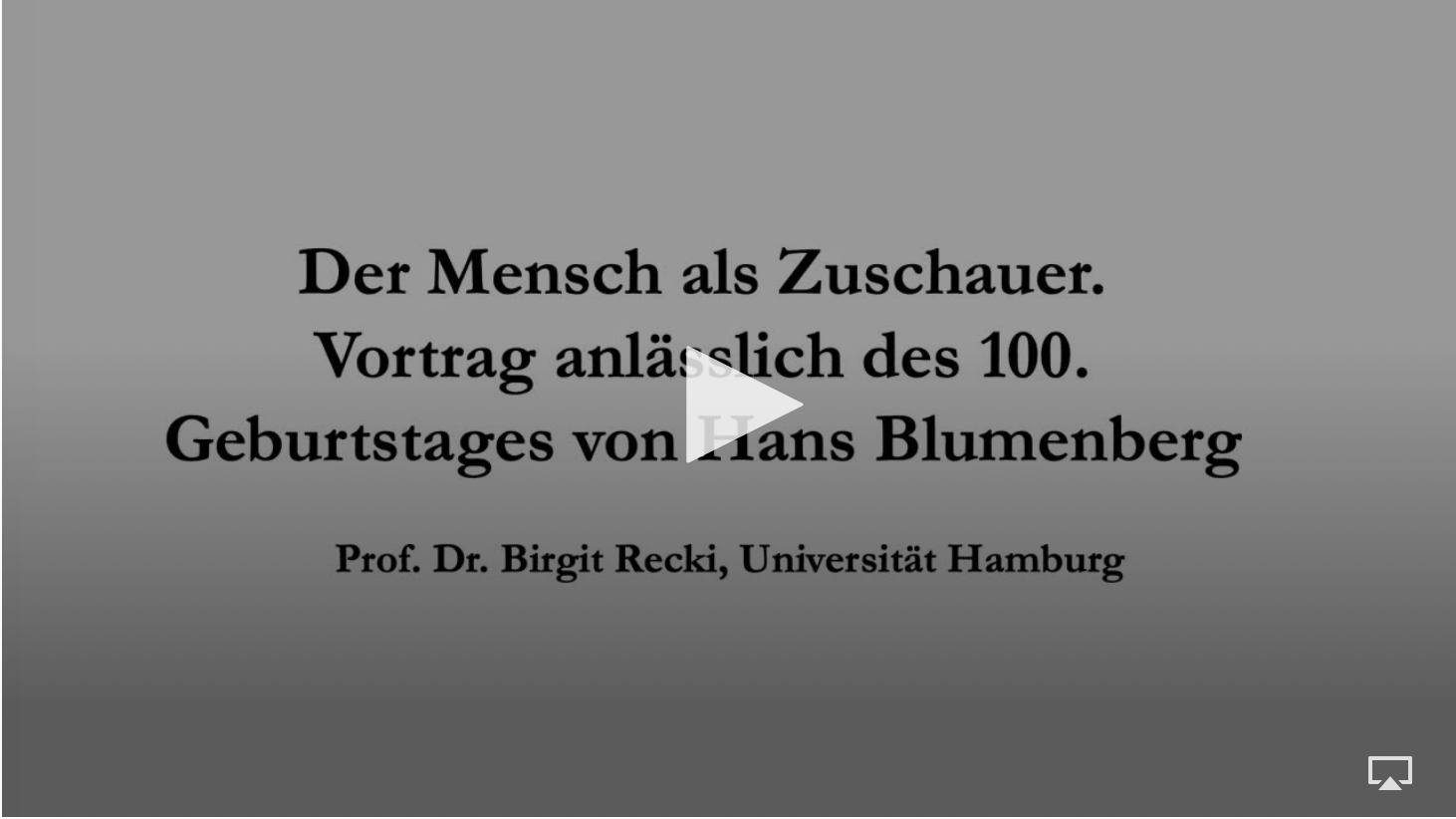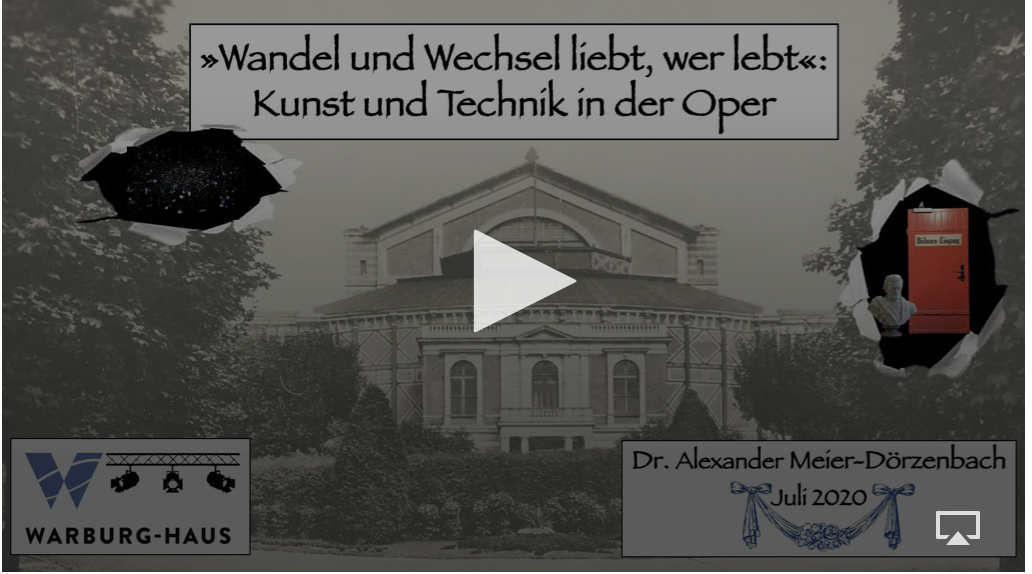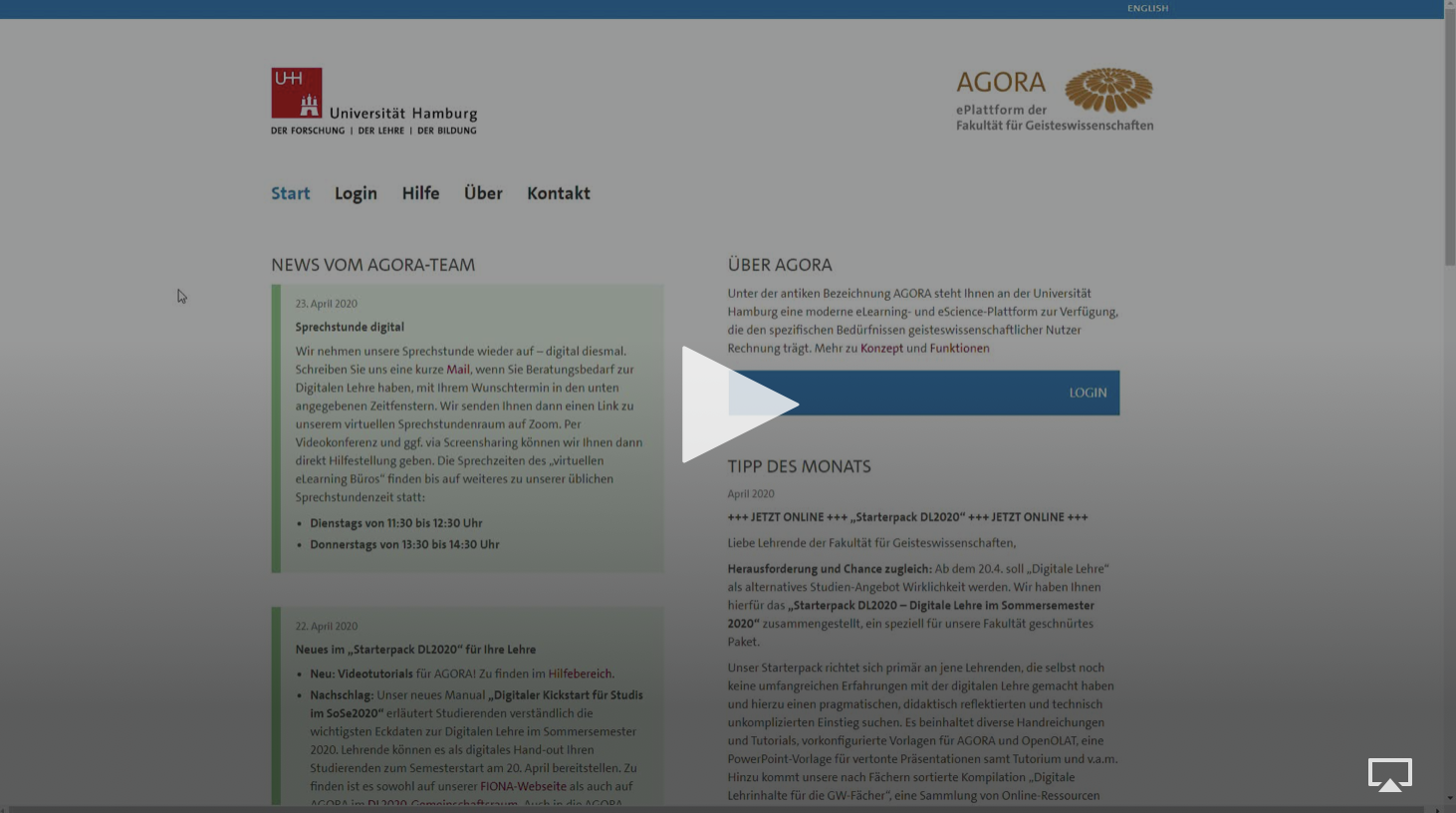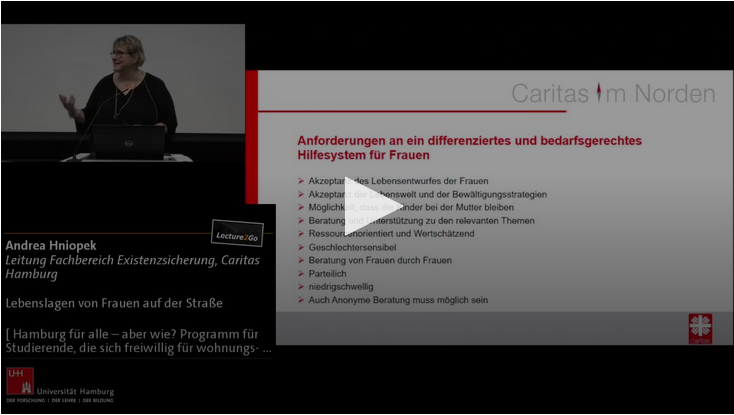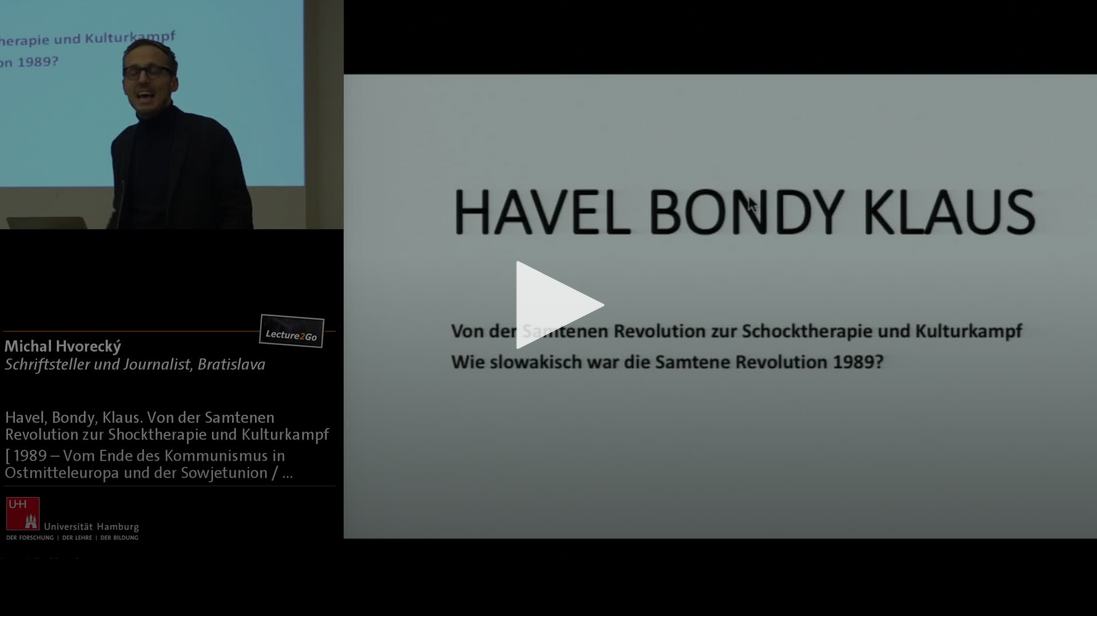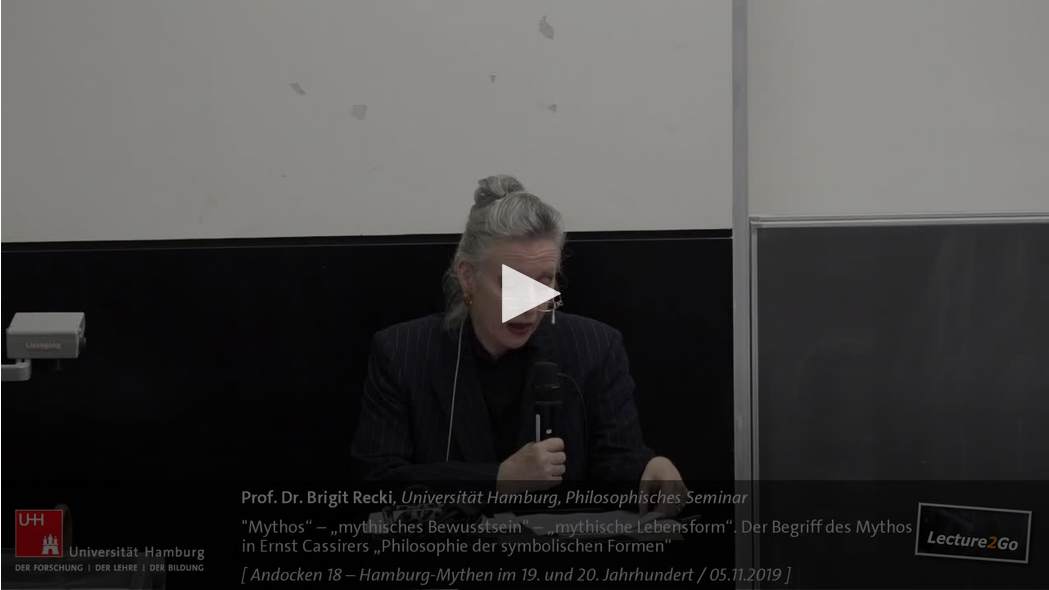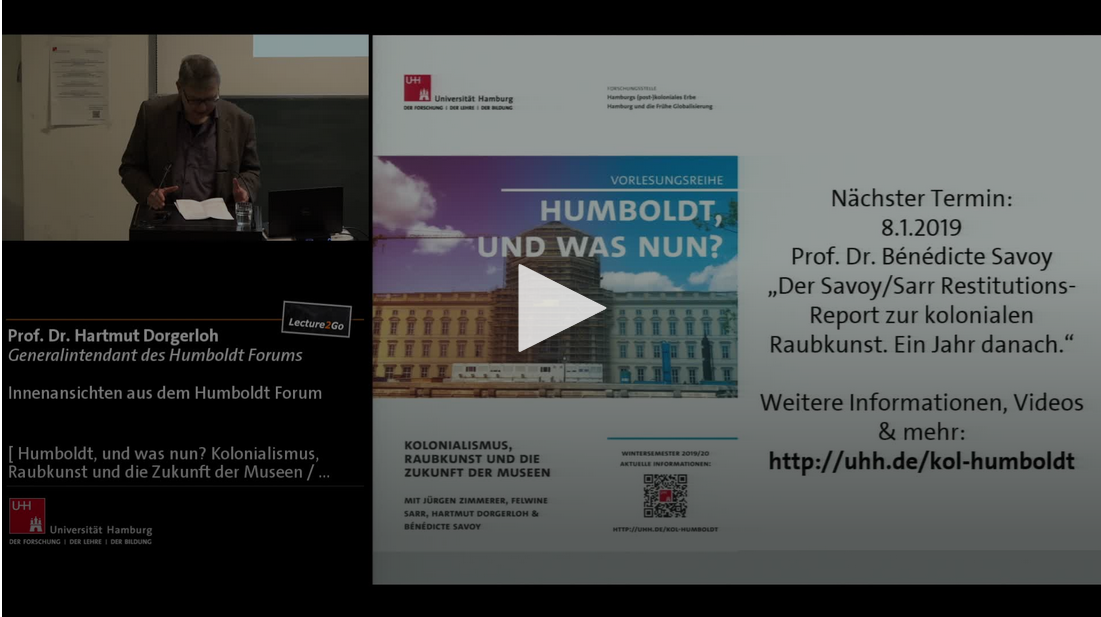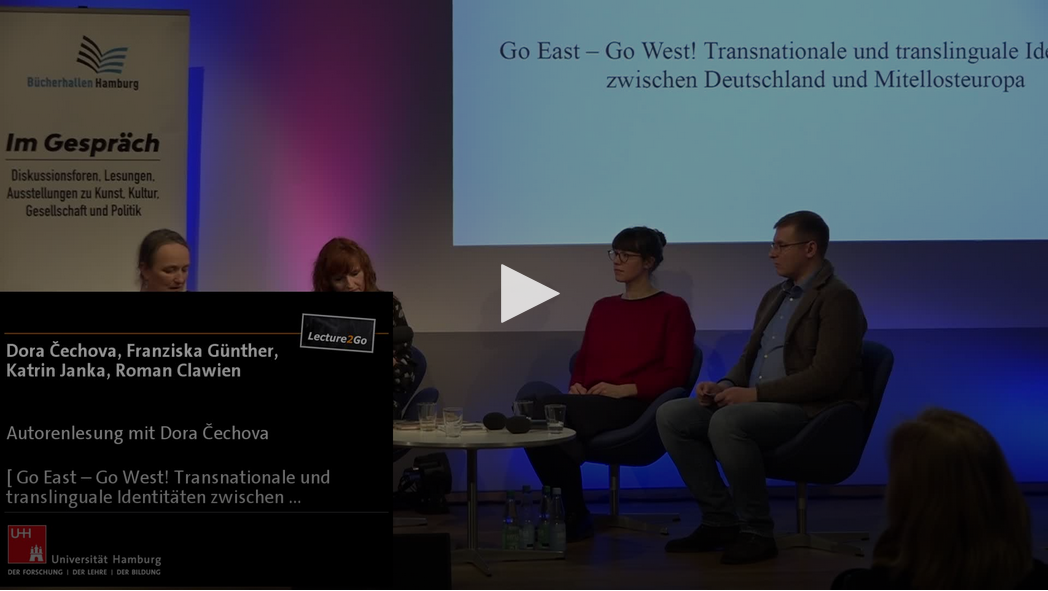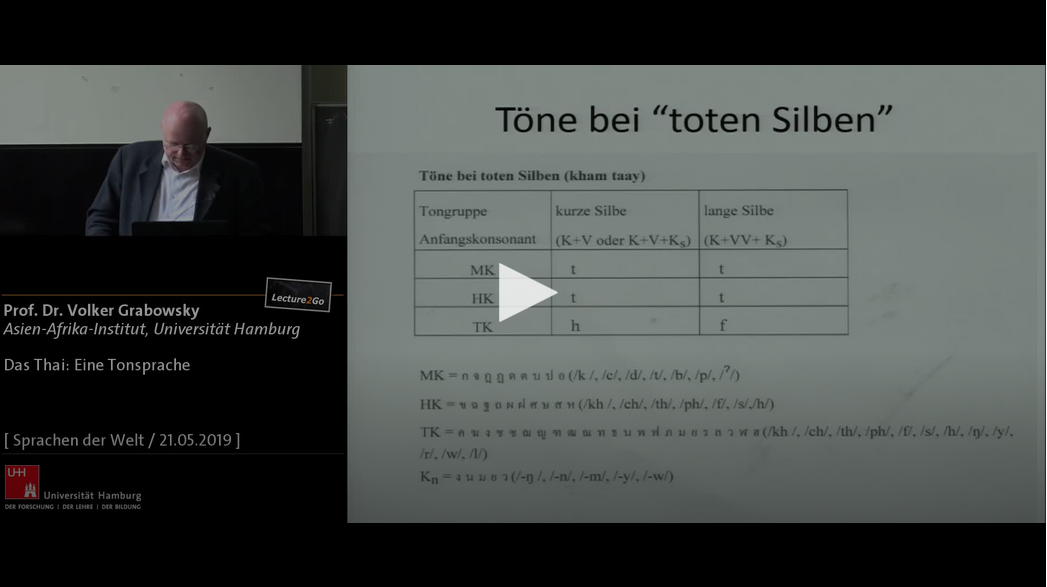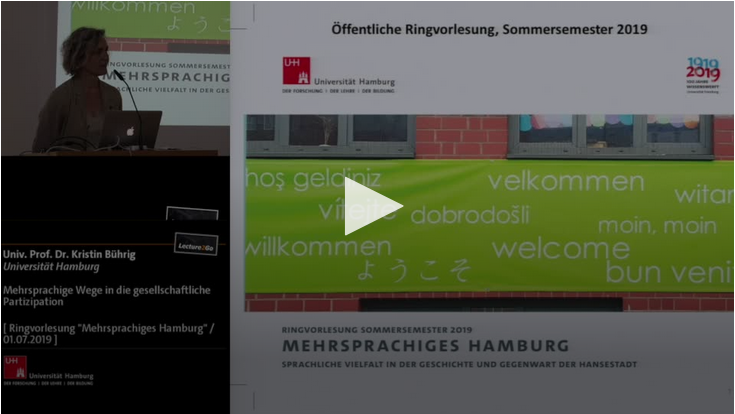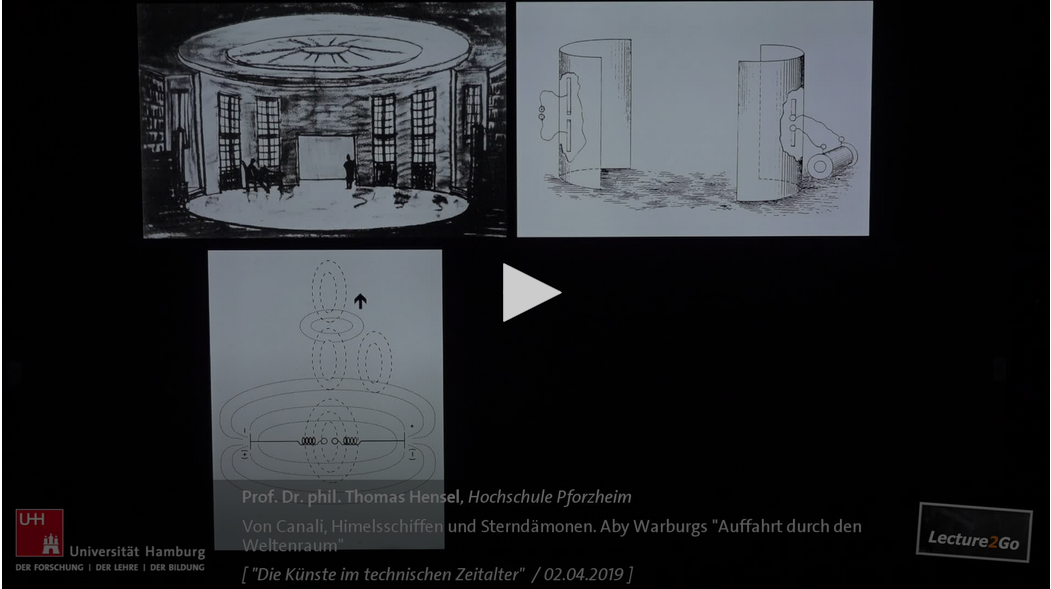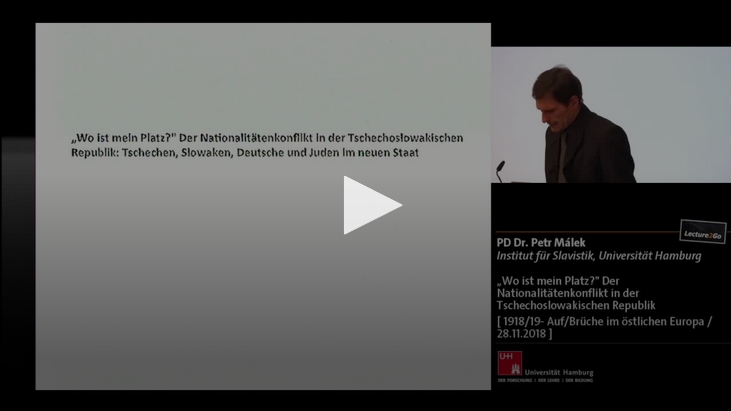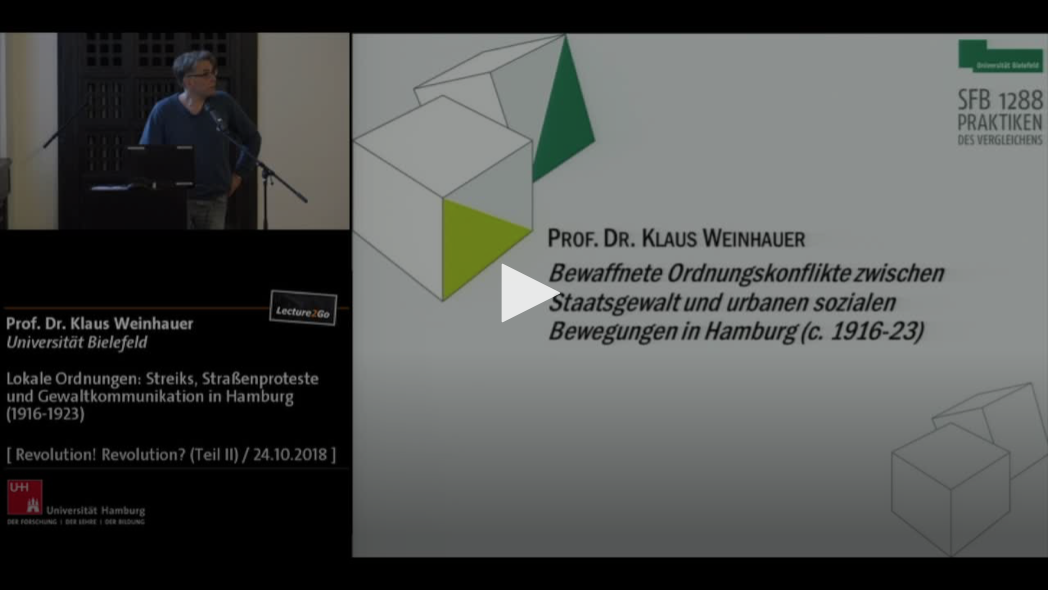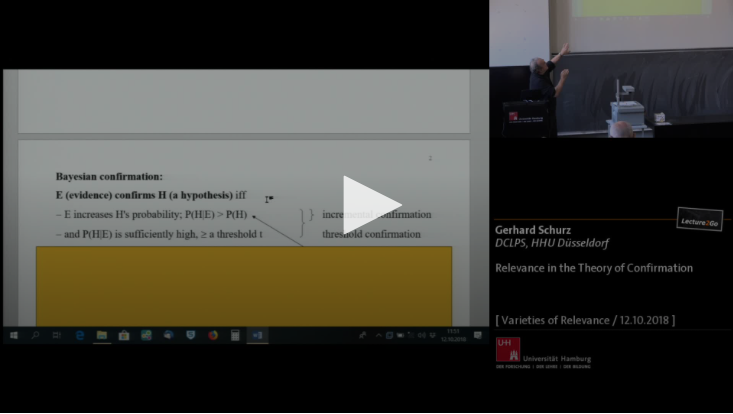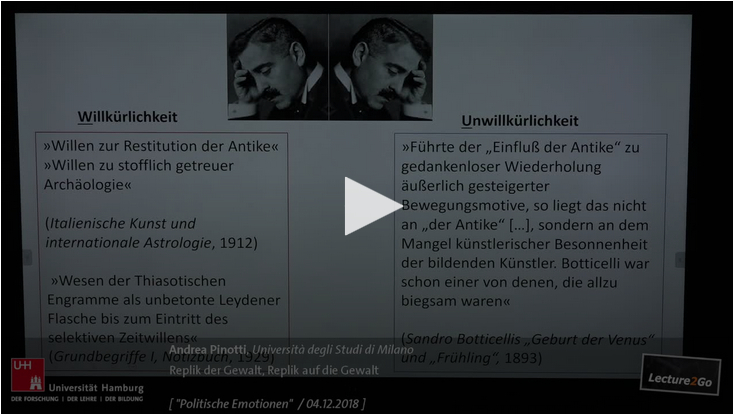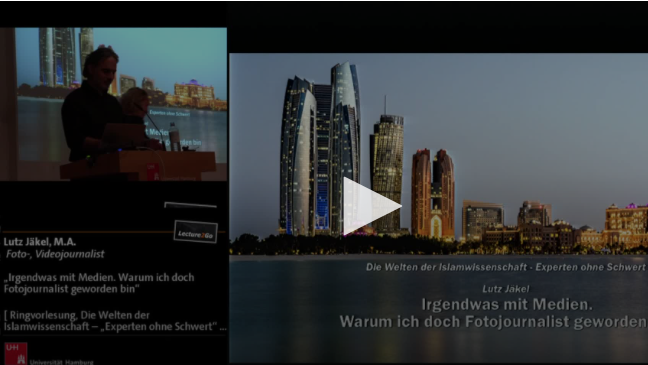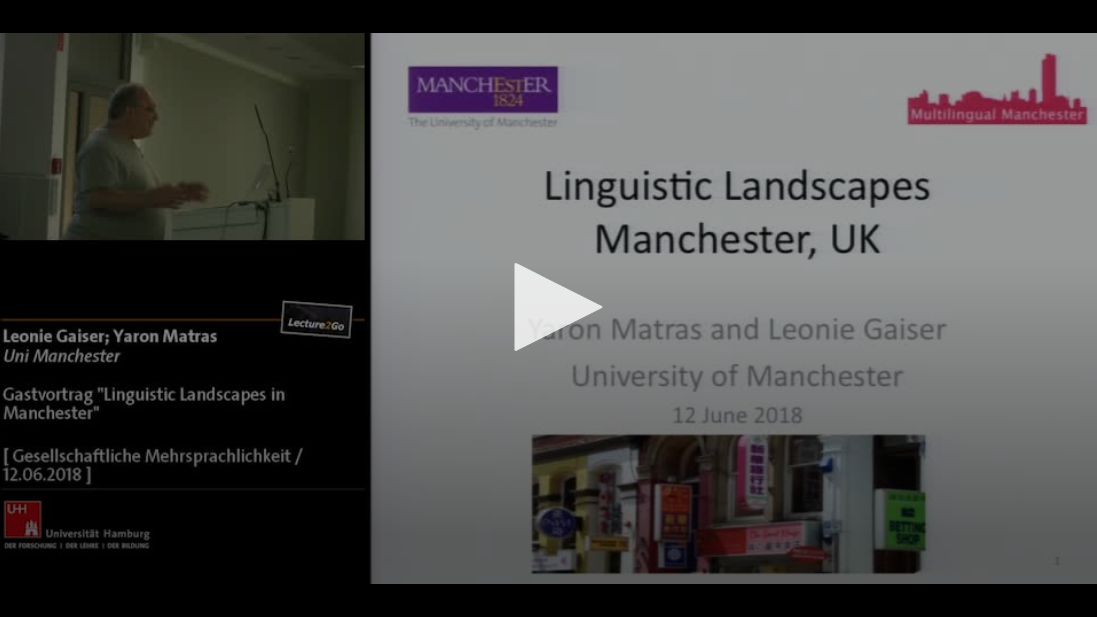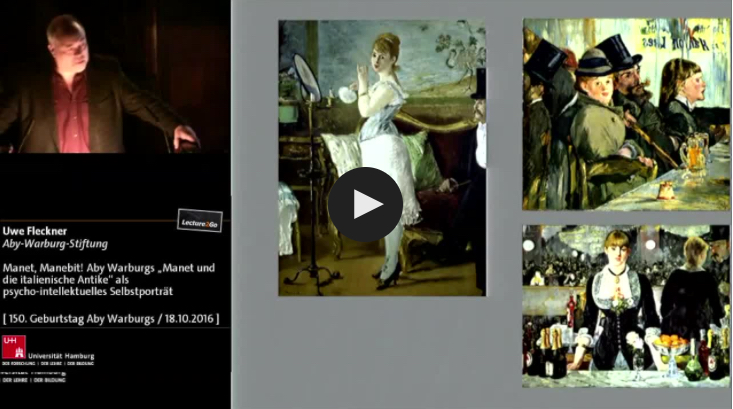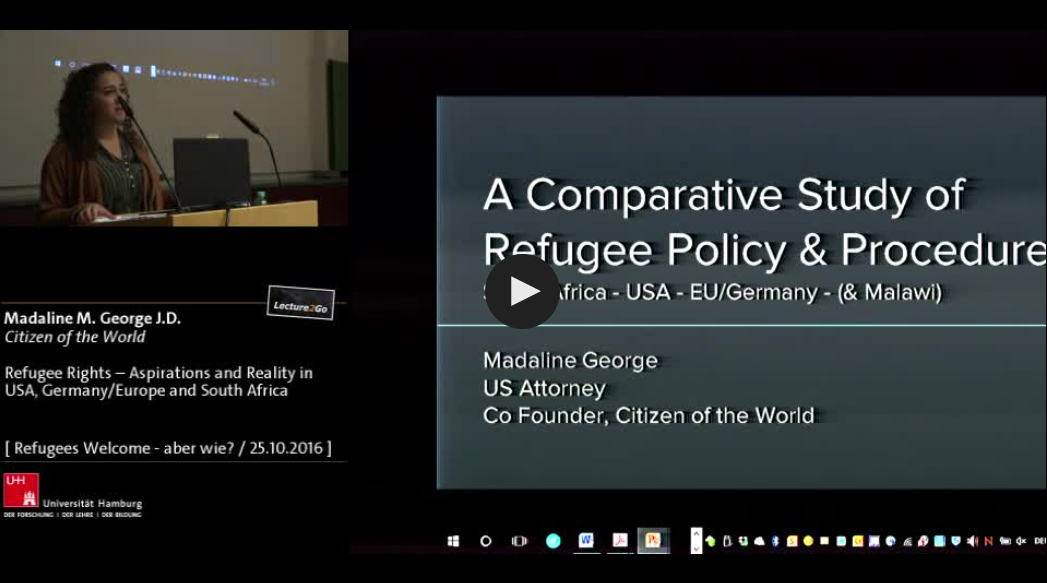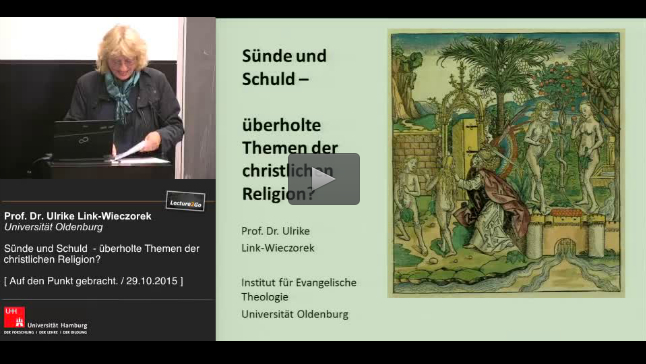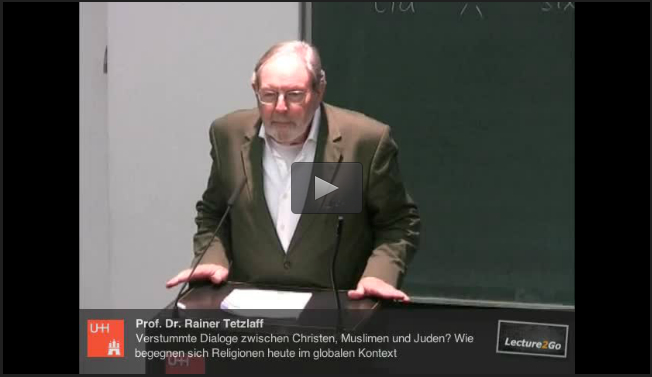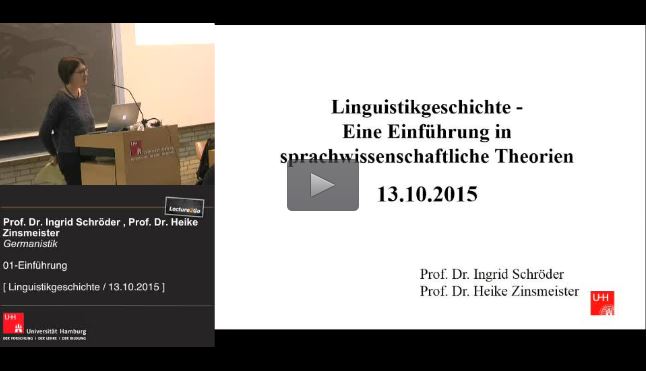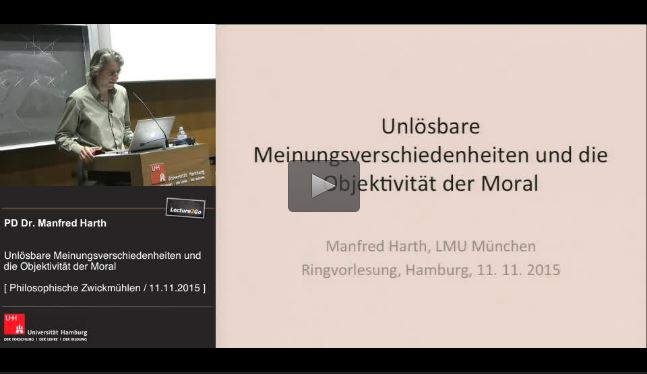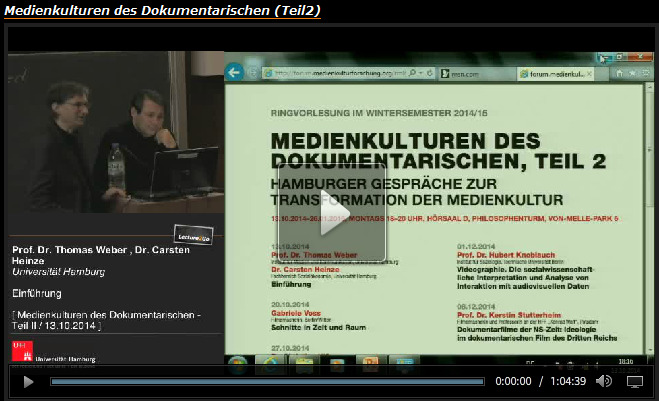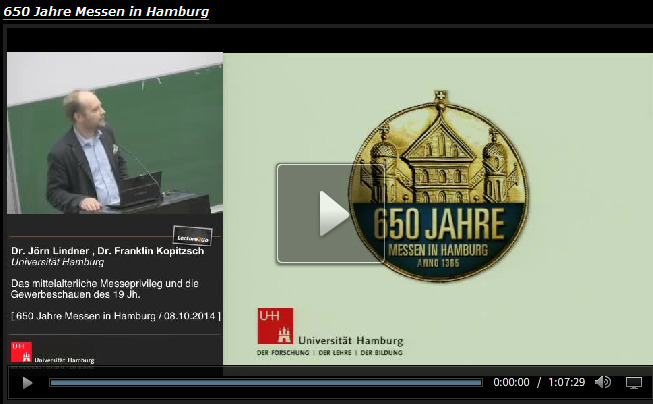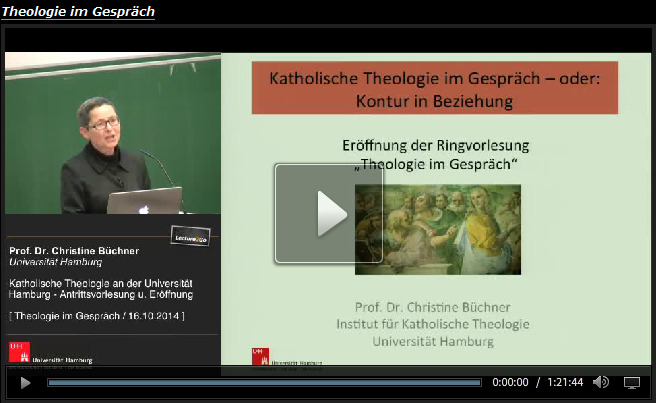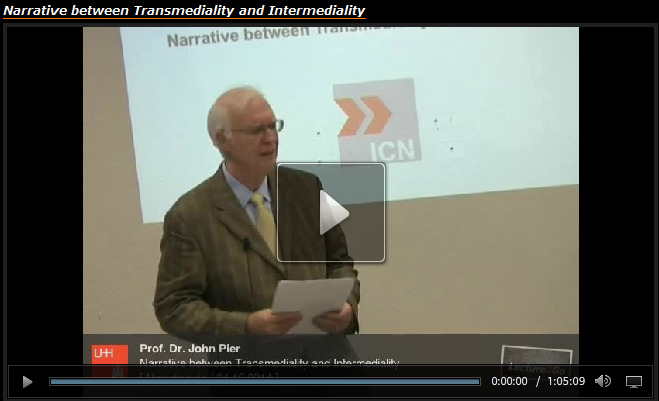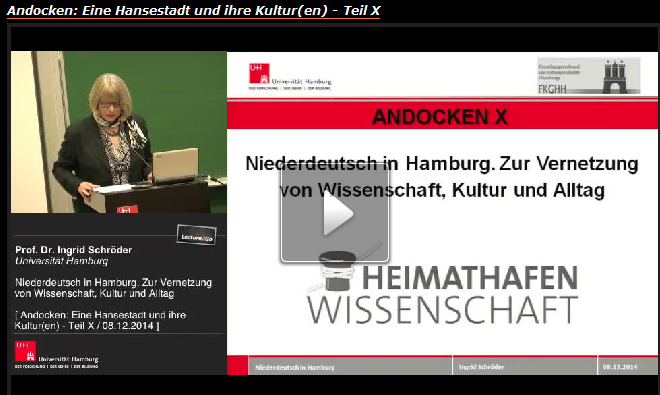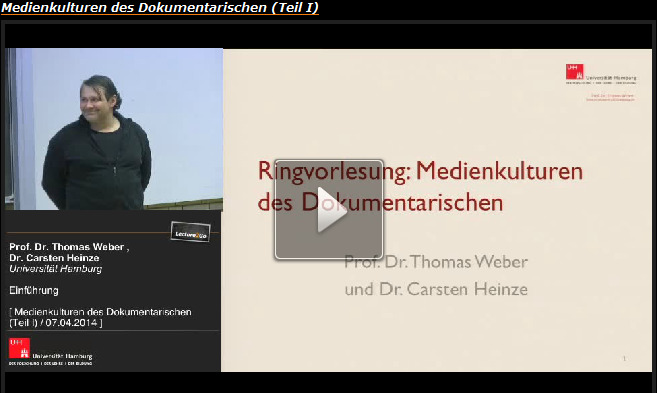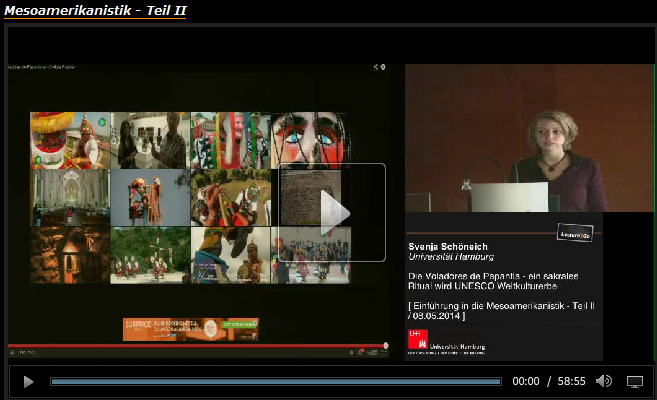Aufzeichnungen von fakultären Lehrveranstaltungen
Hier finden Sie Aufzeichnungen von Vorlesungen, Einzelvorträgen und Autorenlesungen, die als Veranstaltungen der Fakultät für Geisteswissenschaften durchgeführt wurden und zumeist von unserem Team besorgt wurden.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2025
Kriegsende 1945 in Europa. Ereignisse, Erfahrungen, Deutungen
Koordination: Prof. Dr. Birthe Kundrus, Prof. Dr. Kirsten Heinsohn und Dr. Kim Wünschmann
Am 8. Mai 2025 jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs – ein einschneidendes Datum in der Geschichte, das ganz Europa und damit auch Hamburg tief geprägt hat. In den sechs Jahren zuvor hatten unter deutscher Führung in ganz Europa bis dahin unvorstellbare Kriegsverbrechen und Gewaltexzesse stattgefunden. Millionen Menschen wurden rassistisch oder politisch verfolgt, Millionen während und nach dem Krieg vertrieben, Millionen ermordet. Inmitten dieses Geschehens entfaltete sich der Völkermord an den europäischen Juden, der Holocaust.
Mit dem Ende des Krieges verbanden viele Menschen die Hoffnung auf Frieden, Bestrafung der Schuldigen und ein Leben in Freiheit. Doch die Ereignisse wie das eigene Handeln und damit auch die Lehren, die man aus dieser Katastrophe ziehen sollte, wurden sehr unterschiedlich gedeutet. Die Ringvorlesung nimmt den Jahrestag zum Anlass, die Erfahrungen während Krieg und Besatzung wie die Erwartungen nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in ihrer Vielfalt wie Widersprüchlichkeit vorzustellen und zu reflektieren.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Audiodatei auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7664
Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Vortragsreihe.
Philosophy by Hand: The Agency of Manuscripts in Shaping Human Thought (Vortragsreihe)
Koordination: Yoav Meyrav, Hanna Gentili, and José Maksimczuk
“Philosophy by Hand” reflects on the interaction between philosophical ideas and their expression in material form. The series’ premise is that philosophical manuscripts are not mere contains of text, but rather places where philosophy happens. This perspective leads to new questions, new methods, and new forms of cooperation among disciplines. Each lecture will convey in a friendly and engaging manner the causal role manuscripts play in philosophical activity in different languages, eras, and cultural spheres. The first round of speakers will focus mainly on Medieval and Renaissance philosophical manuscripts. Future rounds will widen the scope with reference to eras, geography, and writing media.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7608.
Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Vortragsreihe.
Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)
Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.
Dazu gehört der Vortrag:
- 01.07.25 – Serpents and Rituals at the Crossroads of Contemporary Indigenous Art in Brazil
Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2025)“. +++ Der Link zur „Lecture2Go“-Serie wird zeitnah veröffentlicht. +++
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2024/25
Philosophy by Hand: The Agency of Manuscripts in Shaping Human Thought (Vortragsreihe)
Koordination: Yoav Meyrav, Hanna Gentili, and José Maksimczuk
“Philosophy by Hand” reflects on the interaction between philosophical ideas and their expression in material form. The series’ premise is that philosophical manuscripts are not mere contains of text, but rather places where philosophy happens. This perspective leads to new questions, new methods, and new forms of cooperation among disciplines. Each lecture will convey in a friendly and engaging manner the causal role manuscripts play in philosophical activity in different languages, eras, and cultural spheres. The first round of speakers will focus mainly on Medieval and Renaissance philosophical manuscripts. Future rounds will widen the scope with reference to eras, geography, and writing media.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7608.
Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Vortragsreihe.
Poetry Debates IV: Lyrik nach der Natur / Poetry after Nature (Veranstaltungsreihe)
Koordination: Antje Schmidt und Claudia Benthien
„ich taute Grönland auf mit meinem Blick, / ich schmolz die Gletscher, während ich sie voll / der Andacht überflog.“ Marion Poschmann führt in diesen Versen das dramatische Schmelzen der Gletscher im 21. Jahrhundert auf menschliche Tätigkeiten zurück, insbesondere auf das Fliegen mit dem Flugzeug. Denn mit dem Eintritt ins Zeitalter des Anthropozäns ist der Mensch zur alles verändernden Naturkraft geworden. Er hat sich mit seinen Technologien ebenso machtvoll wie zerstörerisch in jeden Winkel der irdischen Bio- und Atmosphäre eingeschrieben, sodass die vermeintlichen Grenzen zwischen Menschen, Technologien und Natur zunehmend bedeutungslos werden – und damit ebenso der Begriff der ‚Natur‘ selbst. Doch zugleich sind ökologische Themen in der Lyrik so relevant wie nie, gerade in Zeiten der schwelenden Klimakatastrophe und des sechsten Massenaussterbens. Somit stellt sich aktuell auf drängende Weise die Frage: Was sind Stellenwert und Aufgabe des Gedichts nach der Natur?
Im Rahmen der Poetry Debates IV möchten wir aktuelle poetologische, kulturelle und gesellschaftliche Debatten rund um die Bedeutung von Lyrik nach dem Zusammenbruch gängiger Vorstellungen von ‚Natur‘ diskutieren: Welche Imaginationswelten, Verfahren und Darbietungsformen benötigen Gedichte in Zeiten schwelender ökologischer Katastrophen? Kann Poesie mögliche Zukünfte jenseits zerstörerischer Herrschaftsverhältnisse entwerfen? Welche Rolle spielt speziell die gewaltvolle deutsche Geschichte im Zusammenhang mit Verhandlungen der Umwelt? Welche Rollen spielen Science- und Climate-Fiction im Gedicht? Wie relevant sind queere und postkoloniale Perspektiven in der Gegenwartslyrik nach der Natur? Ebenso ist nach Veränderungen in der Rolle von Lyriker*innen zu fragen: Muss Poesie in Zeiten der menschengemachten Klimakatastrophe aktivistisch sein, um etwas bewirken zu können? Offen ist auch, ob es für eine posthumane Wende vonnöten ist, Akteur:innen jenseits des Menschen Handlungsmacht zuzugestehen – etwa: digitaler Technologie, Künstlicher Intelligenz sowie Tieren und Pflanzen. Oder ist es letztlich doch unmöglich, im Medium der Poesie dem menschlichen Standpunkt zu entkommen?
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7596.
Weitere Informationen und alle Termine finden sie auf der Seite der Veranstaltungsreihe.
Populärkultur in Osteuropa und Zentralasien (Ringvorlesung, Mi 16–18 Uhr, ESA O 221)
Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner / Dr. Marina Gerber, beide Osteuropastudien und Slavistik / Prof. Dr. Monica Rüthers, Geschichte / Prof. Dr. J. Otto Habeck, Ethnologie, alle Universität Hamburg
Die Populärkultur ist ein besonders produktives Feld der zeitgenössischen Kultur. Sie ist zugleich auch ein politisch und ästhetisch umstrittenes Feld: In der Populärkultur werden aktuelle gesellschaftliche Themen verhandelt und neue ästhetische Ausdrucksformen entwickelt. Zugleich wird Populärkultur aber oft auch als Teil einer Kulturindustrie wahrgenommen, die gesellschaftliche Konformität stiftet und entpolitisierend wirkt.
35 Jahre nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Regierungen in Mittel-, Nordost- und Südosteuropa und der Sowjetunion sind polnische Comics, tschechischer Rap und ukrainische Soaps Teil der europäischen Populärkultur. Die Ringvorlesung nähert sich dem Phänomen Populärkultur aus unterschiedlichen interdisziplinären Richtungen und fokussiert Pop in den baltischen Ländern, in Zentralasien und in Bezug auf die Minderheiten in der Russischen Föderation.
In Zusammenarbeit mit der Dt. Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), Nordost-Institut (IGKN e.V.), Studiengang Osteuropastudien, Universität Hamburg und der Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7606.
Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)
Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.
Dazu gehören die Vorträge:
Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter den Serien „Warburg-Haus (2024)“ und „Warburg-Haus (2025)“.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2024
Judenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antizionismus – aktualisierte Formen antijüdischer Gewalt (Ringvorlesung, Mi 18–20 Uhr, ESA O 221)
Koordination: Prof. Dr. Monica Rüthers, Fachbereich Geschichte: 4. Arbeitsbereich Europäische Geschichte, Universität Hamburg / PD Dr. Andreas Brämer, Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGDJ)
Judenfeindlichkeit ist wieder aktuell – und das gleich in mehreren Kontexten. Dabei stehen Debatten um Definitionen des Antisemitismus-Begriffs, postkoloniale Israelkritik und der Nahostkonflikt im Fokus. 2023 entbrannten erst Diskussionen um die an der Documenta 15 gezeigten stereotyp antijüdischen Bilder. Nach dem mörderischen Pogrom der Hamas auf israelischem Boden am 7. Oktober wurde die brutale Gewalt an Juden vielerorts öffentlich gefeiert – auch in Deutschland. In Europa und den USA zeigte sich eine Form der Judenfeindlichkeit, die sich als postkolonial versteht und ohne historisches Wissen auskommt. Auch die Jugend in postmigrantischen Gesellschaften in Europa folgt nicht der "deutschen Gedenkkultur", sondern TikTok. Die Veranstaltungsreihe beleuchtet diese Debatten und Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und geht auf historische Traditionslinien, überkommene Argumentationsweisen und postkoloniale Aktualisierungen ein.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7512.
Koloniale Leerstellen der Erinnerung – Colonial Voids of Memory: Hamburg and Germany in Global Perspective (Vorlesungsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA M)
Koordination: Prof. Dr. Jürgen Zimmerer, Fachbereich Geschichte, Arbeitsbereich Globalgeschichte / Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe in Kooperation mit dem Forschungsprojekt WONAGO, Universität Hamburg
Die ‚koloniale Amnesie‘ bricht langsam auf, die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte hat in den letzten Jahren rapide Fortschritte gemacht. Dennoch bleiben viele Leerstellen und Konfliktfelder: In den letzten Monaten haben nicht nur die Verhandlungen mit Namibia um Entschädigungen für den Genozid an Herero und Nama eine neue Schärfe bekommen, auch Tansania hat eigene Stand-punkte verdeutlicht. Im Rahmen seiner Reise nach Tansania sprach der Bundespräsident sogar eine Entschuldigung aus. Zugleich macht sich in Deutschland ein Zurückdrängen kritischer Perspektiven zu Kolonialismus und Rassismus bemerkbar, in Hamburg fehlt das postkoloniale Erinnerungskonzept nach wie vor.
Die Vorlesungsreihe mit Vortragenden aus Tansania, Namibia und Deutschland will diese und andere Leerstellen beleuchten, und gleichzeitig die Forderung nach einem Perspektivwechsel einleiten.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie zum Teil auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7540.
Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, Phil E)
Koordination: Prof. Dr. Sophie Witt / Prof. Dr. Matthias Schemmel / Dr. Franziska Kutzick, alle Institut für Liberal Arts & Sciences, Universität Hamburg
Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?
Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die „Liberal Arts and Sciences“ gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einem gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7520.
Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)
Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.
Dazu gehören die Vorträge:
- 23.01.24 – Dämonenkraft. Heimsuchungen (in) der Moderne.
- 14.05.24 – Borrowed Forms, Singular Meanings: Rethinking 19th Century Art from Brazil.
- 04.06.24 – Unter Hochdruck. Hydraulik als Paradigma der Kulturwissenschaft.
- 18.06.24 – Über Menschlichkeit in finsteren Zeiten: Hannah Arendt in Hamburg.
Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2024)“.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2023/24
Fokus Osteuropa: Gewalt und Gewaltforschung interdisziplinär (Ringvorlesung, MI 16–18 Uhr, ESA O 221)
Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner, Osteuropastudien und Slavistik / Prof. Dr. Monica Rüthers, Geschichte / Prof. Dr. J. Otto Habeck, Ethnologie, alle Universität Hamburg / in Zusammenarbeit mit Dt. Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO) / Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg / Nordost-Institut IKGN / Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr
Gewalt erweist sich als Kontinuum der Geschichte, ist daher immer aktuell und wird in zahlreichen Disziplinen intensiv erforscht. Da uns der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in besonderem Maß beschäftigt, befasst sich die Ringvorlesung mit Aspekten der Gewalt und verschiedenen Ansätzen der interdisziplinären Gewaltforschung im größeren Kontext dieses Krieges. Im Zentrum der Beiträge stehen politische und kulturelle Entwicklungen unter den Bedingungen von Krieg und Militarisierung mit einem Schwerpunkt auf Russland.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7437
Gendering Knowledge: Intersektionale Perspektiven auf Wissen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, ESA C)
Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner / Jun.-Prof. Dr. Dustin Breitenwischer / Jun.-Prof. Dr. Daniel Fliege / Jun.-Prof. Dr. Lina Herz / Jun.-Prof. Dr. Elisa Linseisen / Jun.-Prof. Dr. Julia Nantke / Jun.-Prof. Dr. Lars Vorberger / Dr. Franziska Kutzick, Zentrum Gender & Diversity, alle Universität Hamburg
Geschlecht konstituiert Wissen und Wissen konstituiert Geschlecht. Die wechselseitige Abhängigkeit und Bedingtheit von Gender und Wissen ist allgegenwärtig – sei es in der Sprache, Literatur, Kunst, in den Medien, in der Geschichtsschreibung, in der Politik, im Gesundheitswesen oder in der Arbeitswelt. In diesen Bereichen muss die Produktion und Rezeption von Wissen immer auch intersektional gedacht und analysiert werden, d.h. das Zusammenwirken verschiedener Ebenen von Diskriminierung und Unterdrückung, Emanzipation und Selbstermächtigung. Neben Geschlecht rücken hier Machtachsen wie Sexualität, Herkunft, Klasse, Alter und Be_hinderung in den Blick. Welches Wissen über diese Achsen wird in den verschiedenen Feldern und historischen Kontexten vorausgesetzt und wie formiert sich weiterhin in denselben ein jeweils spezifisches Wissen über sie?
Die Ringvorlesung versucht, – aus einer geisteswissenschaftlichen Perspektive – die Strukturierung und Organisation von Wissen in den genannten Bereichen zu erhellen und kritische Bezüge zu gesellschaftlichen (Macht-)Diskursen herauszuarbeiten.
Hinweise: Die Veranstaltungen werden für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7454.
ILAS: Freiheit in dunklen Zeiten (Ringvorlesung, MI 17.01.2024, 18–20 Uhr, ESA C)
Koordination: Sophie Witt, Christine Hentschel
Anlässlich der Eröffnung des Studiengangs Liberal Arts & Sciences fragen wir nach der «Freiheit in dunklen Zeiten» und freuen uns sehr, mit Oliver Nachtwey und Eva von Redecker zwei inspirierende Denker:innen der Gegenwart gewonnen zu haben.
Wie können wir uns heute auf die Freiheit beziehen? Angesichts von Endzeitstimmung, neuen Autoritarismen, prekären Welt- und Selbstverhältnissen, ökologischer Katastrophe? Anlässlich der Eröffnung des Studiengangs Liberal Arts & Sciences fragen wir nach «Freiheit in dunklen Zeiten».
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation des Instituts für Liberal Arts & Sciences mit der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe Zukünfte der Nachhaltigkeit – und damit Auftakt unserer inter-fakultären Zusammenarbeit zwischen GW und WiSo innerhalb des Studiengangs LAS!
Hinweis: Diese Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/68438.
Poetry Debates III: Lyrik als Ware? Populäre Poesie zwischen Sprachkunst und Kommerzialisierung (Vortrag, MI 29.11.2023, 19:30–21:30 Uhr, Phil C)
Koordination: Henrik Wehmeier in Zusammenarbeit mit Claudia Benthien
Lyrik erfährt in der Gegenwart eine ungeahnte Aufmerksamkeit. Poetry-Slam Veranstaltungen verzeichnen immer neue Besucherrekorde und erreichen mit ihren YouTube-Aufzeichnungen hohe Aufrufzahlen, ‚Instapoetry‘ wird sowohl in den Sozialen Medien als auch im Buchformat millionenfach gelesen. Und auch die traditionelle Buchlyrik erfährt einen Aufschwung, Christian Metz bezeichnet die Gegenwart als Blütezeit der deutschsprachigen Lyrik. Diese Popularität geht naturgemäß jedoch auch mit kritischen Stimmen einher, unterhaltsamen Formaten etwa wird eine Kommerzialisierung vorgeworfen, die literarische Qualität schwinde. Folglich entfachen diese populären Formate im Feuilleton sowie in der Wissenschaft immer wieder Debatten um die Frage, was eigentlich als Lyrik bestimmbar ist und was nicht. Die sinkenden Verkaufszahlen (gedruckter) Bücher wiederum setzen der traditionellen Lyrik zu, die Lyriker:innen sind trotz „Blütezeit“ ökonomisch vor allem auf Lesungen, Literaturpreise und Stipendien angewiesen.
Wem gehört die Lyrik also? Mit dieser provokanten Frage möchten die Poetry Debates III aktuelle Debatten rund um die Gegenwartslyrik und ihre alten und neuen medialen Formate aufnehmen und mit Lyriker:innen, Verleger:innen, Wissenschaftler:innen und der Öffentlichkeit diskutieren. Wer entscheidet, was als Lyrik zählt? Warum ist es so wichtig, ob etwas als Lyrik anerkannt wird oder nicht? Diese Diskussion entfaltet sich auch anhand von Songtexten, über deren poetische Qualität diskutiert wird. Und auch der traditionelle, gedruckte Gedichtband wird zunehmend kritisch hinterfragt, führt nicht zuletzt die Digitalisierung zu massiven Veränderungen im Buchmarkt. Wie reagieren Verleger:innen auf diese Veränderungen? Was bedeutet es für Lyriker:innen, wenn sie durch Preise und Stipendien ökonomisch in einem immer stärkeren Abhängigkeitsverhältnis zu staatlichen Institutionen oder privaten Geldgeber:innen stehen? Diese wiederum sind kritischen Fragen ausgesetzt, wer eigentlich Zugang zur oft als elitär bezeichneten Lyrik hat.
Hinweis: Diese Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/68095.
Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)
Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.
Dazu gehören die Vorträge:
- 27.10.23 – Image and Pharmakon. Aby Warburg's Self Healing.
- 19.12.23 – Rubens' Weltenbrand: Imaginarien der Apokalypse, um 1620.
- 23.01.24 – Dämonenkraft. Heimsuchungen (in) der Moderne.
Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter den Serien „Warburg-Haus (2023)“ und „Warburg-Haus (2024)“.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2023
Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, ESA C
Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner, Prof. Dr. Matthias Schemmel, Nina Elena Eggers
Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?
Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die "Liberal Arts and Sciences" gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einen gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.
Hinweis: Die Veranstaltungen werden für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/7324
Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)
Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.
Dazu gehören die Vorträge:
- 09.05.2023 – Prof. Dr. Barbara Baert: Rocks and Tears. Niobe's Fate as Dynamics of Form
- 04.07.2023 – Prof. Dr. Christopher Wood: Albrecht Altdorfer unter den Marketendern: Formen und Wanderungen des Kriegsvolks
Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2023)“.
Rags to Riches: Preaching to the Poor in Ancient Japan (Vortrag, DI 06.06.2023, 18–20 Uhr, ESA M)
Standard accounts claim that Buddhism in the eighth and ninth centuries was limited to courtly and aristocratic circles, only becoming popular in later times. But recent archaeological evidence shows that Buddhism had spread to villages across the archipelago by the start of the ninth century. Preachers often traveled between provincial villages, performing sermons and rituals for local communities. My paper focuses on sermon materials that address poverty. Preachers at once blamed the poor as karmically responsible for their poverty while also advocating for accessible practices that erased class distinctions. I will combine this textual evidence in the form of sermon notes with excavated potsherds and wooden slips that suggest poor people may have found these teachings attractive. Using these sources, I will argue that Buddhism was “popularized” centuries earlier than our standard narratives would suggest, crossing geographic boundaries and social classes.
Hinweis: Diese Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/66777.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2022/23
Wozu noch Religion? Zur Situation der Theologie in der säkularisierten Moderne (Ringvorlesung, MO 18–20 Uhr, ESA H)
Koordination: Dr. Dr. Florian Baab
Im 21. Jahrhundert ist Religion – zumindest in den Ländern Europas – kein Phänomen mehr, das sich von selbst versteht: Nur noch eine Minderheit der Menschen sieht ein religiöses Bekenntnis als zentrales Element des eigenen Selbstverständnisses, und viele Menschen ohne konfessionelle oder religiöse Bindung vermissen offensichtlich nichts. Hat daher eine Theologie, die den Anspruch erhebt, den Menschen als ein grundsätzlich transzendenzorientiertes Wesen zu deuten, ausgedient? Oder steht sie in der säkularisierten Moderne vor der Herausforderung, die eigenen Aufgaben neu und anders zu bestimmen?
Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Ringvorlesung: Wozu noch Religion? Zur Situation der Theologie in der säkularisierten Moderne“
Einwanderung, Exil, Flucht – Formen der Migration im und aus dem östlichen Europa (Ringvorlesung, MI 16–18 Uhr, ESA W 221 & Wiwi B1)
Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner, Osteuropastudien / Slavistik, UHH; Prof. Dr. Monica Rüthers, Geschichte, UHH; Prof. Dr. J. Otto Habeck, Ethnologie, UHH In Zusammenarbeit mit DGO, Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg, IKGN, HSU
Gerade erlebt Deutschland durch Geflüchtete aus der Ukraine und der Exilierung russischer oder belarussischer Intellektueller Formen der Migration, die nach der Systemwende 1989/1991 und dem Ende des II. Weltkriegs historisch geworden zu sein schienen. Hierdurch treten andere Formen der Migration wie Arbeitsmigration, nomadische oder transnationale Lebensentwürfe in den Hintergrund, die in den letzten beiden Jahrzehnten die Wahrnehmung und öffentliche Diskussion des Themas dominiert haben. Die Ringvorlesung will die verschiedenen Formen von Exil, Flucht und Migration zwischen Deutschland und Mittelosteuropa und Osteuropa in den Blick nehmen und analysieren. Das Ziel der Vortragsreihe ist es, Formen geographischer und kultureller Mobilität aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen (Geschichte, Kulturwissenschaft, Ethnologie, Literaturwissenschaft, Politikwissenschaften) zu beleuchten. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Differenzierung von freiwilliger vs. erzwungener Migration (Flucht, Vertreibung, Exil) liegen.
Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Einwanderung, Exil, Flucht – Formen der Migration im und aus dem östlichen Europa“
Veranstaltungen im Warburg-Haus (Vorträge, verschiedene Termine, Warburg-Haus)
Auch in diesem Semester wurden verschiedene Vorträge im Warburg-Haus aufgezeichnet und auf der Plattform „Lecture2Go“ einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt.
Dazu gehören die Vorträge:
- 22.11.2022 – Prof. Dr. Gregor Wedekind: Wirkungsmacht und Handlungsfeld. Zum Nachleben von Théodore Géricaults Floß der Medusa
- 05.01.2023 – Victor I. Stoichita: Text – Bild – Textur. Zu den »Spinnerinnen« von Diego Velázquez
Hinweis: Die Videos der Vorträge im Warburg-Haus finden Sie unter der Serie „Warburg-Haus (2022)“.
CISAL Lecture Series: New Research in the History of Ancient Law (Ringvorlesung, DI 18–20 Uhr, ESA J & ESA W 221)
Koordination: Prof. Dr. Matthias Armgardt, Prof. Dr. Kaja Harter-Uibopuu, Prof. Dr. Werner Rieß (UHH)
Die erste Ringvorlesung des CISAL (Center for the Interdisciplinary Study of Ancient Law) wird sich in zwölf Gastvorträgen der Vielfalt des interdisziplinären Forschungsfeldes der antiken Rechtsgeschichte widmen. Dazu werden die geographische, chronologische und typologische Bandbreite der verfügbaren Quellen aufgezeigt und die Ansätze und Methoden beider Disziplinen beleuchtet. Darüber hinaus werden die eingeladenen Referenten, allesamt renommierte Wissenschaftler des Antiken Rechts oder der Alten Geschichte, Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte geben.
Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Videos auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „CISAL Lecture Series: New Research in the History of Ancient Law“
Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, DO 18–20 Uhr, ESA M)
Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner, Prof. Dr. Matthias Schemmel, Nina Elena Eggers
Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?
Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die „Liberal Arts and Sciences“ gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einem gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.
Hinweis: Die Veranstaltungen wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen“
On Art and Resistance in Ukraine (Vortragsreihe, verschiedene Termine, 19 Uhr, ESA W 120)
Koordination: Prof. Dr. Petra Lange-Berndt, Kunstgeschichtliches Seminar; Prof. Dr. Anja Tippner, Slavistik
Ziel der Veranstaltunsgreihe ist es, den Dialog über diese drängenden Themen an der UHH zu ermöglichen und den Unterdrückten ein Zuhören und eine kontinuierliche Unterstützung bei ihren Versuchen, ihre eigene Subjektivität wiederzuerlangen, zu gewähren. So sollen die Veranstaltungen anregen, über die blinden Flecken und Mythen nachzudenken, die in westlichen Kontexten in Bezug auf die zeitgenössische ukrainische Kunst sowie die Kunstgeschichtsschreibung – in Vergangenheit und Gegenwart – angesichts der russischen Invasion zu finden sind. In insgesamt drei Veranstaltungen geht es um Themen wie die Rolle von bewegten Bildern in Kriegszeiten, aktuelle Entwicklungen in der ukrainischen Gegenwartskunst und dekoloniale Ansätze.
Die Veranstaltungsreihe wird organisiert von den Studierenden des Kunstgeschichtlichen Seminars, Natalya Stupka und Denis Uhreniuk, und moderiert von Mariia Vorotilina, Kampnagel Hamburg.
Weitere Informationen und ein Programm finden Sie auf der Website der Vortragsreihe.
Hinweis: Die Veranstaltung wird für Sie als Video auf der Plattform „Lecture2Go“ bereitgestellt: „Revolution at War: Art and Politics in Ukraine“
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2022
Schauplatz Ukraine: Geschichte, Politik und Kultur (Ringvorlesung, 14-tägig, MI 18:15 – 19:45, ESA C)
Verantwortliche Organisation: Prof. Dr. Anja Tippner, Osteuropastudien der Universität Hamburg, in Zusammenarbeit mit DGO Zweigstelle Hamburg, IKGN Lüneburg, IFSH, Universität Hamburg
Durch den militärischen Angriff der Russländischen Föderation ist die Ukraine in das Zentrum der europäischen Aufmerksamkeit gerückt. Die Vortragsreihe beleuchtet wichtige Aspekte der aktuellen Krise und gibt vertiefende Einblicke in die ukrainische Geschichte und Kultur sowie das russisch-ukrainische Verhältnis aus der Perspektive von Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft, Friedens- und Sicherheitsforschung, Ethnologie und Slavistik.
Termin: Mittwoch, 18–20 Uhr, 14-tägig (ab 06.04.2022)
Ort: Hörsaal ESA C, Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude der Universität Hamburg
Präsenzveranstaltung
Hinweis: Die Veranstaltungen werden als Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „RV Schauplatz Ukraine (SoSe 22)“ auf Lecture2Go.
60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen – DA SIND WIR! (Vortragsreihe, verschiedene Termine, MI 18:15 – 19:45, ESA H)
Organisation: Tobias Völker
Anlässlich des sechzigsten Jahrestags des Anwerbeabkommens im vergangenen Jahr nimmt die TEZ-Vortragsreihe im Sommersemester die kollektiven Gedenknarrative kritisch in den Blick und rückt weniger beachtete Aspekte in den Fokus. Im Zentrum steht dabei explizit die Perspektive der „Gastarbeiter*innen“ und ihrer Nachkommen, ihre (Selbst-)Positionierung in der postmigrantischen deutschen Gesellschaft. So wird die Vielschichtigkeit transkultureller Identitätsprozesse in mehrgenerationellen Familienzusammenhängen beleuchtet und die in der deutschen Mehrheitsgesellschaft weit verbreitete Vorstellung einer weitgehend homogenen „türkischen Community“ in deutschen Großstädten hinterfragt, indem Stimmen ethnischer und religiöser Minderheiten unter den „Türkei Stämmigen“ zu Wort kommen und Beispiele für eine Rückbesinnung der diasporischen Enkel*innengeneration auf kulturelle und sprachliche Traditionen beleuchtet werden. Zugleich werden fremdenfeindliche Gewalt und multisektionale Diskriminierungserfahrungen thematisiert sowie Beispiele für migrantische Selbstorganisation im Kampf gegen Rassismus aufgezeigt. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf sprachlichen und künstlerischen Auseinandersetzungen mit Migrationserfahrungen, Zugehörigkeitsdiskursen und identitätsstiftenden Praktiken liegen, wie sie in Journalismus, Theater, Literatur und Musik verhandelt werden. Hierbei wollen wir bewusst Hamburger Kulturschaffende einbinden, um eine Diskussion über migrantische Lebensrealitäten und gesellschaftliche Perspektiven in unserer Stadt anzustoßen. Studierende der Turkologie Hamburg ergänzen das Programm mit ihren individuellen und wissenschaftlichen Überlegungen zum Thema Migration.
In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg
Zeit: 06.04.2022 - 06.07.2022, mittwochs, 18-20 Uhr ct.
Ort: ESA Hauptgebäude, Hörsaal H (Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg)
Hinweis: Die Veranstaltungen werden als Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „TEZ-Vortragsreihe (SoSe22)“auf Lecture2Go.
Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (Ringvorlesung, 14-tägig, DO 18:15 – 19:45, ESA M)
Organisation: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner; Franziska Kutzick
Was bedeutet die Klimakrise für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Auswirkungen haben die globalen Migrationsbewegungen? Wie können nachhaltigere Stadt-Räume gestaltet werden? Fragen, die sich mit den Herausforderungen unserer Gegenwart beschäftigen, können nur durch interdisziplinäre Herangehensweisen beantwortet werden. Doch wie sieht fachübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaft eigentlich aus? Welche Schnittstellen finden sich zwischen den Kulturwissenschaften und der Biologie, der Geschichte und der Medizin oder der Literaturwissenschaft und der Physik? Auf welche Weise nähern sich Forscher:innen unterschiedlicher Fächer aktuellen Themen? Worin liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Perspektiven – und wie kann daraus etwas Neues entstehen?
Die Ringvorlesung ermöglicht interdisziplinäre Begegnungen zu der Frage, wie heute die „Liberal Arts and Sciences“ gestaltet werden können. In jeder Sitzung betrachten zwei Wissenschaftler:innen verschiedener Forschungsdisziplinen einem gemeinsamen Gegenstand und tauschen sich darüber aus. Interdisziplinäres Arbeiten und Denken wird so ganz praktisch sichtbar und performativ erlebbar.
Termin: Donnerstag, 18–20 Uhr, 14-tägig (ab 14.04.2022)
Ort: Hörsaal ESA M, Edmund-Siemers-Allee 1, Hauptgebäude der Universität Hamburg
Präsenzveranstaltung
Hinweis: Die Veranstaltungen werden als Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „Liberal Arts and Sciences: Interdisziplinäre Begegnungen (SoSe22)“auf Lecture2Go.
Optimizing Code for Performance: Reading ./code --poetry (Konferenzvortrag, FR 20.05.22, 20:00 – 21:30, Staatsbibliothek)
Lecture Performance „Optimising Code for Performance: Reading ./code --poetry“ des Lyrikers Chris Kerr
In seiner Lecture Performance präsentierte der Lyriker Chris Kerr (GB) Code Poetry, die er zusammen mit dem Programmierer Dan Holden (CA) verfasst hat. Dabei handelt es sich um in Quellcodes geschriebene Gedichte, die zugleich ausführbare Computerprogramme sind. Die digital-poetische Arbeit von Kerr und Holden wirft unter anderem Fragen nach den Funktionsweisen von Programmiersprachen, nach der Beziehung von maschineller und menschlicher Sprache sowie nach ihren visuell-kinetischen und auditiv-performativen Dimensionen auf. Neben Einblicken in die Geschichte des Genres und der Diskussion des Verfassens von Code Poetry zeigte Kerr eindrücklich, wie diese – auf den ersten Blick überwiegend visuelle – Form von Lyrik mündlich aufgeführt werden kann. Auf der Webseite https://code-poetry.com/ können die Code Poems, die außerdem in Buchform publiziert sind (./code --poetry, 2016), in Aktion betrachtet werden.
Die Lecture Performance fand am 20. Mai 2022 im Rahmen der Konferenz „Lyrik und zeitgenössische Visuelle Kultur / Poetry and Contemporary Visual Culture“ (19.-21. Mai) des Forschungsprojekts Poetry in the Digital Age in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky statt. Das Projekt wird durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) gefördert und von Prof. Dr. Claudia Benthien (Institut für Germanistik, Universität Hamburg) geleitet. Die erste internationale und interdisziplinäre Konferenz des Projekts widmete sich dem Verhältnis von poetischer Sprache und (audio-)visuellen Medien und fragte nach den Potentialen von zeitgenössischer Lyrik für eine (post-)digitale Sprach-, Bild- und Medienkritik. Konzipiert und geleitet wurde die Konferenz von Dr. Wiebke Vorrath und Magdalena Korecka, M.A. aus dem Sub-Projekt „Poetry and Contemporary Visual Culture“.
Mit
Chris Kerr (Lyriker, Brighton/GB)
Daniel Holden (Programmierer, Montreal/CA)
Moderatorin: Dr. Wiebke Vorrath (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, ERC-Projekt; Hamburg)
Hinweis: Die Veranstaltungen werden auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Das Video finden Sie unter „Optimizing Code for Performance: Reading ./code --poetry“ auf Lecture2Go.
Von Natur aus unberührbar? Magrittes „images peintes“ und die Geschichte der gemalten Gegenstände (Vortrag, DI 14.06.2022, 19:00 – 20:30, Warburg-Haus)
Die von René Magritte in seinen späten Jahren ausgearbeitete Malereitheorie wurde als Reprise idealistischer Kunsttheorien und ideologische Verbrämung einer ganz anders gearteten künstlerischen Praxis gedeutet. Magrittes Thesen, etwa dass gemalte Bilder von Natur aus unberührbar sind und nichts verbergen, sind jedoch wesentlich aufschlussreicher als vermutet. Eine genauere Analyse lässt Zusammenhänge mit der Wahrnehmungsphysiologie des 19. Jahrhunderts erkennen. Sie zeigt außerdem, dass Magrittes Theorie einen unabgegoltenen Wahrheitsgehalt birgt und als berechtigter Einspruch gegen die Scheingewissheiten eines gedankenlosen Bilderkonsums verstanden werden darf. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man die von ihm so genannten »gemalten Bilder« mit einer Reihe seltsamer Wesen vergleicht, die schon seit der Antike, jedoch fast unbemerkt durch philosophische und kunsttheoretische Schriften geistern und die traditionell als ›gemaltes Auge‹, ›gemalte Rose‹, ›gemalte Pfeife‹… oder abstrakter als ›gemalte Gegenstände‹ bezeichnet wurden.
Wolfram Pichler ist a.o. Professor für Kunstgeschichte an der Universität Wien. Er studierte Kunstgeschichte und Philosophie an den Universitäten München und Wien, wo er 1999 mit einer Studie über die Schminke der Maler promoviert wurde und sich 2015 mit kunsthistorischen Beiträgen zur Bildtheorie habilitierte. Im Jahr 2000 war er Visiting Fellow an der Harvard University, 2003/4 Postdoc-Stipendiat am Kunsthistorischen Institut in Florenz, 2012/13 Senior Fellow am Internationalen Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie in Weimar, 2013 Gastprofessor an der École des Hautes Études en Siences Sociales in Paris sowie Getty Scholar am Getty Research Institute in Los Angeles, 2017 Mercator-Stipendiat der DFG. Seine historischen und theoretischen Arbeiten stehen in der Tradition jener bildgeschichtlichen Wende, die das Fach Kunstgeschichte im ausgehenden 20. Jahrhunderts besonders in Deutschland und Frankreich genommen hatte. Seine Publikationen betreffen vor allem die europäische Malerei der Frühen Neuzeit und Moderne, die Theorie und Geschichte der Zeichnung sowie die Bildtheorie.
2022 hat Wolfram Pichler die Aby-Warburg-Stiftungsprofessur inne.
Hinweis: Die Veranstaltung wird in einer Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „Warburg-Haus (2022)“ auf Lecture2Go.
Wie digitale Bilder politisch mobilisieren. Gender, Rassismus und Klimadebatten im Vergleich (Vortrag, MO 04.07.2022, 19:00 – 20:30, Warburg-Haus)
Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe 2022 zum Jahresthema »Bilder als Akteure des Politischen – Sozial- und Kunstwissenschaftliche Perspektiven« in gemeinsamer Kooperation von Warburg-Haus und Hamburger Institut für Sozialforschung.
Gemeinsam mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS) lädt das Warburg-Haus herzlich ein zum Vortrag von Nicole Doerr:
Wie verwenden soziale Bewegungen und Aktivist:innen von Fridays for Future Bilder in digitalen Medien oder Straßenprotesten, um auf Klimagerechtigkeit aufmerksam zu machen? Wie übersetzen Black Lives Matter Aktivist:innen in Köln, Kopenhagen oder Nuuk das Thema Rassismus in visuelle Performancekunst? Welche Bilder des Hasses und der Feindlichkeit gegenüber liberalen Demokratien und liberalen Werten verbreiten rechtsextreme Netzwerke in den USA und Europa über digitale Medien? Der Vortrag untersucht diese empirischen Forschungsfragen aus der Perspektive politikwissenschaftlicher und kunstgeschichtlicher Theorien und Methoden. Er kombiniert Ansätze der visuellen Ikonografie mit kritischen soziologischen und multimodalen Ansätzen der kritisch historischen Diskursanalyse. Die Fallbeispiele stammen aus Forschungsprojekten zur Bilddatenbank rechtsextremer digitaler Kommunikation in Europa und den USA, zu Black Lives Matter und zu Klimaprotesten.
Nicole Doerr ist Associate Professor am Department of Sociology der Universität Kopenhagen.
Im Rahmen der Veranstaltungen zum Schwerpunktthema »Bilder als Akteure des Politischen II«.
Hinweis: Die Veranstaltung wird in einer Serie auf der Plattform „Lecture2Go“ aufgezeichnet und bereitgestellt. Die Serie finden Sie unter „Warburg-Haus (2022)“ auf Lecture2Go.
Warburg Haus - Verschiedene Vorträge
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2021/22
Andocken 20: ErinnerungsTopografie / Hamburger Geschichtslandschaften (Vortragsreihe, Di. 18.30 - 20.00 Uhr, Zoom)
Gedenkstätten, Denkmäler, Museen, Straßennamen als Aushandlungsorte des kulturellen Gedächtnisses in Hamburg
Die Hamburger Geschichtslandschaft mit ihren städtischen Gedenkorten, Straßennamen, Denkmälern und (Wiederauf-)Bauprojekten – von der Gedenkstätte Neuengamme über das Lagerhaus G bis zum Bismarck-Denkmal und zu der „Peking“ – ist Gegenstand brisanter erinnerungspolitischer ,Aushandlungsprozesse‘. Die Vorlesungsreihe wirft anhand aktuell lebhaft diskutierter Projekte (z. B. Initiative Bornplatz-Synagoge, Gedenkort Stadthaus, Emily-Ruete-Platz) facettenreiche Schlaglichter auf eine Reihe urbaner Erinnerungsorte und die sie ,bespielenden‘ lokalen wie überregionalen Akteur*innen. Im gemeinsamen Gespräch werden jene Hamburger Lieux de Memoiren (Pierre Nora) als Kristallisationspunkte beleuchtet, die immer wieder Reflektion und Aktion, Reaktion und Widerstand herausfordern. Als mögliche Projektionsflächen für lokale Zugehörigkeiten und Identitäten verweisen sie stets auch auf deren historische Dimension und damit auf eine spezifische Hamburgische Erinnerungskultur. Zur Bestandsaufnahme einer entsprechenden „Erinnerungstopografie / Hamburgischen Gedächtnislandschaft“ mit ihren Debatten und Kontroversen möchte die gleichnamige Ringvorlesung einladen und anhand verschiedener Zugänge zur Geschichte Aspekte der Gegenwart wie auch zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten offenlegen.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage findet diese öffentliche Ringvorlesung ab sofort nur noch digital statt. Bitte registrieren Sie sich für die gewünschten Vortragstermine unter folgendem Link:
https://uni-hamburg.zoom.us/webinar/register/WN_DRWU0-WQQlOdQNHdXepEFg
Koordination: Dr. Johanna Meyer-Lenz / Dr. Markus Hedrich / Dr. Myriam Isabell Richter / Prof. Dr. Andreas Körber / Prof. Dr. Thorsten Logge, alle Universität Hamburg und FKGHH
Das obige Video finden Sie zusammen mit weiteren Aufnahmen aus der Vortragsreihe auf Lecture2Go.
Philosophische Ästhetik (Vorlesungsreihe, Do. 18.15 - 19.45 Uhr, L2Go)
Vortragende: Prof. Dr. Birgit Recki
Die Ästhetik, die sich als selbständige Disziplin der Philosophie erst im 18. Jahrhundert herausgebildet hat, befasst sich mit den auf reflektierter Sinneswahrnehmung und Gefühl beruhenden Erfahrungen, insbesondere mit den intensiven Eindrücken von Natur und Kunst wie dem Schönen und Erhabenen. Unerachtet der Tatsache, dass ihre Fragen – im Rahmen von Metaphysik und Ontologie, Erkenntnislehre und praktischer Philosophie, Poetik und Rhetorik – das philosophische Denken seit Anbeginn beschäftigen, müssen sie bis heute gegen das Vorurteil verteidigt werden, man bewegte sich damit in der Sphäre der angenehmen Nebensächlichkeiten. Dabei haben zwei der großen Menschheitsfragen seit der Antike immer auch in der Ästhetik ihre Antworten bekommen: die im weitesten Sinne erkenntnistheoretische Frage nach dem Anteil der Sinnlichkeit an unseren Erfahrungen aller Art, die sich auf die ästhetische Wahrnehmung und das ästhetische Gefühl richtet; und die gleichermaßen praktische wie metaphysische Frage nach dem Status und Wert des von Menschen Gestalteten im Ganzen der Welt, deren exemplarischer Fall die Werke der Kunst sind. Damit ist die bis in die Gegenwart immer wieder erneuerte theoretische Polarität markiert zwischen Ästhetik als Theorie der ästhetischen Erfahrung und Ästhetik als Theorie der Kunst.
Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.
Warburg-Haus 2021: Fraktur. Weiblichkeit, der gebrochene Blick und das Nachleben der Shoah bei Boris Lurie (Vortrag, Di. 09.11.21, 19 Uhr)
Vortrag der Trägerin des Wissenschaftspreises der Aby-Warburg-Stiftung 2021 im Rahmen des Jahresthemas »Bilder als Akteure des Politischen«.
Das Warburg-Haus bietet 2021 mit seinem Jahresthema »Bilder als Akteure des Politischen« den Raum, politische Bildphänomene in den Blick zu nehmen und Fragen der aktuellen Bedeutung politischer Bilder im globalen Kontext zu diskutieren. Die Politische Ikonographie ist ein historisch gewachsenes Bildphänomen, aber auch die wissenschaftliche Methode seiner Erforschung: In der Kunst- und Bildwissenschaft vermittelt sie ein Verständnis komplexer visueller Lebenszusammenhänge der modernen wie nachmodernen Welt und des politischen Wirkungspotentials von Bildern im Spektrum von Information bis Propaganda. Es war Aby Warburg, der an seiner Hamburger Kulturwissenschaftlichen Bibliothek den Grundstein zu ihrer wissenschaftlichen Erforschung legte, als er sie nicht nur in seine epochen- und gattungsübergreifende Bildforschung einbezog, sondern schon während des Ersten Weltkrieges ein Archiv zur politischen Propaganda des massenmedialen Krieges anlegte, das die agitatorischen Mobilisierungskräfte auf der Grundlage historischer Forschung zu konservieren und analysieren versuchte.
Katharina Sykora, Preisträgerin des Wissenschaftspreises der Aby-Warburg-Stiftung 2021, spricht in ihrem Festvortrag über das Nachleben der Shoah als zentrale Triebfeder in der Kunst Boris Luries. Es trägt Züge einer unabgeschlossenen Performanz, die ein absolutes »Zu spät« und das Echo »danach« zu einem Amalgam verschmilzt und im selben Zug als Bruch in Bild und Sprache hervortreibt. Harte Dichotomien von Tod und Leben, Gewalt und Begehren, Herrschaft und Sklaventum, Männlichkeit und Weiblichkeit klaffen so unversöhnlich auseinander und verkehren sich doch immer wieder bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander.
Visualisierungen des Weiblichen nehmen dabei eine Schlüsselfunktion ein. An ihnen spielt Lurie neben den Bildern der Shoah die extremsten Formen von Alterität durch und nutzt sie, um über existenzielle Ausgrenzungs-,
Disziplinierungs- und Reinigungsmechanismen der westlichen Gesellschaften nach 1945 zu reflektieren. Mit dem provokanten Vorzeigen gesellschaftlich abgespaltener Bilder der weiblichen ›Nackten und Toten‹ und ihrer unentwirrbaren Vermischung bringt Lurie sich auch selbst als Künstler/Autor und uns als Betrachtende in ein gewolltes Dilemma zwischen Schaulust und Abwehr. Aus dieser Zerreißprobe von Verwerfung und Verstrickung wird niemand erlöst, auch nicht im Rahmen ästhetischer Ordnungssysteme.
Wiedergabe der Werke von Boris Lurie nach der fair use policy der Boris Lurie Art Foundation.
Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten des Warburg-Hauses.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2021
Immanuel Kant: Eine Einführung (Vorlesungsreihe, DO 18 – 20 Uhr, Lecture2Go)
Vortragende: Prof. Dr. Birgit Recki
Die Vorlesung gibt eine einführende Gesamtdarstellung der Philosophie Immanuel Kants. Im Zentrum steht die Frage nach dem Sinn einer Kritik der Vernunft und nach deren sachlichen und methodischen Erträgen. Das Unternehmen der Vernunftkritik wird in seinen leitenden Motiven, seinen Problemen, seinem Vollzug, seinen Stationen – und: seinen Einsichten nachvollzogen. Am Ende der Vorlesung soll nicht allein der Prospekt von Kants kritischer Untersuchung der Leistungen und Grenzen der menschlichen Vernunft erschlossen sein; es soll auch klar geworden sein, was Kant meinte, als er die Kritik der Vernunft die Metaphysik von der Metaphysik nannte, was er unter dem Primat der praktischen Vernunft versteht und dass die Kantische Vernunftkritik eine Philosophie der Freiheit ist, und in welchen Dimensionen der menschlichen Welt Kant die Leistungen der Vernunft am Werk sieht.
Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.
Der Faktor Zeit. Neue Interdisziplinäre Perspektiven auf die Gewaltforschung (Ringvorlesung, MI 16–18 Uhr, Zoom)
Koordination: Prof. Dr. Birthe Kundrus, Deutsche Geschichte / Prof. Dr. Werner Rieß, Alte Geschichte, beide Fachbereich Geschichte, Forschungsgruppe Gewalt-Zeiten, Universität Hamburg
Wie prägt Zeitlichkeit Konzeptionen und Wahrnehmungen von Gewalt? Der Attentäter von Halle zum Beispiel stellte sich mit seinem Angriff auf die jüdische Gemeinde an einem hohen Feiertag in eine jahrhundertelange Tradition antijudaistischer Gewalt. Noch im Auto hörte er rechtsextremen Rap. Zeitgleich übertrug er seine Taten ins Internet. Die Bilder zeigen einen Mann, der glaubt, er besäße alle Zeit der Welt. Währenddessen erlebten die in der Synagoge Anwesenden die Minuten des bangen Wartens, ob die Tür halten würde, als endlos. Opfer derartiger Gewalttaten teilen ihre Lebensgeschichte oft in die Zeit vor dem Anschlag und die Zeit danach ein. Im Fall von Halle fragen sie sich auch, was die Zukunft ihnen als Juden in der Bundesrepublik bringen wird.
Schon dieses aktuelle Beispiel zeigt: Zeitlichkeit als eine der Grundkonstanten menschlicher Existenz übt einen entscheidenden Einfluss auf Planung, Gestalt, Ausübung, Erfahrung, aber auch Deutung von Gewaltphänomenen aus. Aus unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Perspektiven widmen sich die Vorträge diesem bislang in der Gewaltforschung wenig beachteten „Faktor Zeit“.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2020/21
Virtuelle Bibliotheksführung
Triage-Entscheidungen im Kontext der Corona Pandemie - der Beitrag der Philosophie
Koordination: Singa Behrens
In der Krise wird das Gewisse ungewiss. Angesichts einer Pandemie, drängen sich existenzielle Fragen auf und wir wissen nicht, was das Gebot der Stunde ist. Die Klimakrise führt uns vor Augen, dass es sich nicht von selbst versteht, dass Wasser fließt, sobald man den Hahn aufdreht. Die kritische Lage der Demokratien zeigt, wie leicht Grundlagen der Verfassungen wie Freiheit und Mitbestimmung der Vergewisserung bedürfen. Die Krise bricht mit der Sicherheit, in der wir uns im Alltag wiegen. Die Philosophie gilt als die Disziplin, die dasjenige hinterfragt, was als gesichert gilt. Aus diesem Grund ist es naheliegend, das Augenmerk darauf zu richten, inwiefern Erkenntnisse, Techniken und Fragestellungen der Philosophie in der Krise relevant sind. Gibt es eine besondere Verantwortung der Philosophie in der Krise? Die Vorträge dieser Ringvorlesung widmen sich dieser Frage. Kann die Philosophie Antworten geben oder bietet sie uns etwas anderes?
Im Wintersemester 20/21 findet die Ringvorlesung digital statt. Wir freuen uns, Ihnen trotz der Einschränkungen in diesem Semester Beiträge zu unserer Ringvorlesung zur Verfügung stellen zu können. Zu den jeweiligen Terminen der Ringvorlesung wird auf der Seite des Philosophischen Seminars ein Link zu der Aufzeichnung des entsprechenden Vortrags veröffentlicht.
Was ist der Mensch? Philosophische Anthropologie
Vortragende: Prof. Dr. Birgit Recki
Was ist der Mensch? Mit Sophokles ein Ungeheuer, mit Sokrates ein zweibeiniges Lebewesen ohne Federn, mit Aristoteles das zoon politikon? Ein schwankendes, aber denkendes Rohr im Wind? Das sinnlich-vernünftige Wesen, das unter normativer Selbstkontrolle aus sich selber etwas macht, wie es Kant, oder das `Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse´, wie es Marx nahe legt? Ein `Mängelwesen´ oder ein reicher Erbe? Bloß ein Säugetier unter anderen, oder das Ziel der Evolution? Animal rationale? Homo faber, Homo sapiens, Homo ludens, Homo publicus?
Die Frage nach dem Menschen ist so alt ist wie die Philosophie. Doch nicht zu allen Zeiten wurde sie so verstanden, dass sie eine eigene Disziplin der Philosophie begründe, geschweige denn so, dass sie deren zentrales Anliegen artikulieren könne: Bis ins 18. Jahrhundert war sie aufgehoben in theologischen und metaphysischen Weltkonzeptionen. Das Zeitalter der Vernunftaufklärung ist nicht zufällig die Gründerzeit der Geschichtsphilosophie, der Ästhetik und: der Anthropologie. Die ungeteilte Aufmerksamkeit auf den Menschen, auf die Leistungsfähigkeit seiner Sinne und seiner Vernunft, den Wert seiner Hervorbringungen, seine Stellung in der Welt ergibt sich aus dem Programm der Aufklärung. Die Bestimmung des Menschen gewinnt mit dieser Verselbständigung beträchtlich an Prägnanz, Präzision und systematischem Anspruch. Einen weiteren entscheidenden Aufschwung erfährt das Interesse am Menschen und seiner Stellung in der Welt, namentlich in der Natur, durch die modernen Lebenswissenschaften seit Darwins großer Provokation. Die philosophische Anthropologie des späten 19. und des 20. Jahrhunderts positioniert sich in der Aufnahme der biologischen Gattungsbestimmungen des Menschen und in der Auseinandersetzung mit ihr.
Die Vorlesung präsentiert ausgewählte Klassiker der philosophischen Anthropologie vom 18. Jahrhundert bis in die zeitgenössische Philosophie.
Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.
Andocken 19: Hamburger*innen erforschen Geschichte(n) | Narrative – Medialitäten der Moderne
Koordination: Prof. Dr. Thorsten Logge / Dr. Johanna Meyer-Lenz / Dr. Markus Hedrich / Dr. Myriam Isabell Richter / Dr. Ralf Erik Werner, alle Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH) und Universität Hamburg
Andocken 19 stellt Beiträge überwiegend zur Hamburger Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert aus der Perspektive unterschiedlichster Medien und Erzählweisen dar. Vorgestellt und diskutiert wird, wie Neuerungen und Veränderungen in den Kommunikationsformen und -techniken (Theater/Film/ Auditive/Videotechnik) zu neuen Darstellungsweisen und Wahrnehmungsmöglichkeiten führen: diese umfassen Sprechkultur im Alltag, auf der Bühne, vor Gericht; Narrative in Stadtführungen; Medien wie Zeitung, Radio, Film, das World Wide Web, Werbung, Zeitungsberichterstattung. Darüber hinaus bietet das digitale Zeitalter hochauflösende multimediale Formate und ermöglicht durch das Zusammenspiel von Foto-, Film-, Video- und Audiotechniken neue Anschauungsweisen.
Ein zweiter Aspekt widmet sich den Narrativen und wendet sich den Fragen nach Gegenstand und Form der Erzählung zu, beschreibt die Wirkung von Visualisierung und Digitalisierung, erörtert die Bezüge Autor*innen, Erzähler*innen und Publikum. Es werden die verschiedensten Formen sprachlicher und medialer Darstellung von Geschichte aus der Sicht von Public History, Stadtführer*innen, Sprach- und Kulturwissenschaften, Gendergeschichte, Globalisierungsgeschichte, Stadtteilgeschichte und Politikgeschichte vorgestellt. Aus aktuellem Anlass schauen wir auch in die USA.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2020
Philosophie der Kultur
Koordination: Prof. Dr. Birgit Recki
Was ist und wozu haben wir Menschen Kultur? Seit der Antike gibt es mythische Vorstellungen und philosophische Auseinandersetzungen über Wert und Unwert der Kultur: Für den Menschen scheint die Natur anders als für die Tiere schlecht gesorgt zu haben (natura noverca). Er bedarf als ein schlecht Weggekommener der Kompensation durch entschädigende Göttergaben, die ihn in Stand setzen, durch die produktive Gestaltung der vorgefundenen Verhältnisse zugleich auch aus sich selbst etwas zu machen. Das Feuer, das Prometheus nach Platons Mythos des Protagoras den Göttern stiehlt und den Menschen bringt, steht dafür als exemplarisch. Im Blick auf den hohen Preis dieser Gabe, auf die Probleme der Entfremdung durch die Eigendynamik einer Welt von Werken, artikuliert sich daraufhin in einer bis in die Gegenwart immer wieder erneuerten Bewertungsalternative zugleich mit der Hochschätzung der Kultur die Kulturkritik: Ist die Kultur als das von Menschen in absichtlicher Tätigkeit Hervorgebrachte das unverzichtbare Korrelat der Natur, oder ist sie etwas Widernatürliches? Hat man die Tat des Prometheus kulturoptimistisch als den Gnadenakt einer zweiten Schöpfung oder kulturpessimistisch als eine Art von Sündenfall zu verstehen? Ist die Kultur das Element der Befreiung – oder wären wir besser dran, wenn wir uns von ihr befreien könnten? In welchem Verhältnis steht das (moralische und politische) Handeln des Menschen (praxis) zu den Werken der Kultur (poiesis)?
Maßgebliche Positionen der Kulturphilosophie sollen an einer repräsentativen Auswahl von Texten (Rousseau, Kant, Nietzsche, Freud, Simmel, Cassirer, Arendt, Blumenberg u.a.) behandelt werden).
Die Videos dieser Aufzeichnung stehen auf Wunsch der Vortragenden nicht mehr zur Verfügung.
Der Mensch als Zuschauer. Vortrag anlässlich des 100. Geburtstages von Hans Blumenberg
„Wandel und Wechsel liebt, wer lebt": Kunst und Technik in der Oper
Koordination: Prof. Dr. Birgit Recki
Dr. Alexander Meier-Dörzenbach
09.07.2020
Warburg-Haus (2020)
Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema "Die Künste im technischen Zeitalter II".
Mit dem Aufbau der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg und der Entwicklung eines Instrumentariums, das Kunst und Bilder über Zeiten und Räume hinweg als soziale, kulturelle und politische Bedeutungsträger ernst nimmt, begründeten die Wissenschaftler*innen um Aby Warburg in Hamburg eine moderne Kunstwissenschaft als Kulturwissenschaft. Für Warburg als technikbegeisterte Person war der Blick auf kulturelle Ausdrucksformen immer auch ein Blick auf das bis in die Gegenwart verfolgte Verhältnis von Kunst, Medien und technischem Wissen. Dieses interdisziplinäre Interesse bietet dem zweijährigen Schwerpunktthema am Warburg-Haus 2019–2020 den Anlass, der Aktualität von Warburgs methodischem Erbe nachzugehen und im Fokus auf das Verhältnis von Kunst und Technik bis heute ungebrochen inspirierende innovative Impulse und Methodenreflexionen aufzugreifen.
Den dritten Vortrag der Reihe im Warburg-Haus 2020 hält der Operndramaturg und Kunsthistoriker Alexander Meier-Dörzenbach zur Technikgeschichte der Oper. Rund um die Uraufführung von Richard Wagners Ring des Nibelungen 1876 beleuchtet er in »konzentrischen Kreisen« das »dynamische Spiel von Technik und Opernkunst«.
Alexander Meier-Dörzenbach hat nach seiner Juniorprofessur für Amerikanistik an der Hamburger Universität und nach Lehraufträgen an mehreren Kunst- und Musikhochschulen als Chefdramaturg am Aalto-Theater Essen gearbeitet und ist nun als Dramaturg und Kulturlehrender freischaffend tätig. Er kooperiert seit über 20 Jahren fest mit dem Regisseur Stefan Herheim für Inszenierungen an deutschen und internationalen Opernhäusern (u.a. Bayreuther und Salzburger Festspiele, London, Amsterdam, Oslo, Berlin, Glyndebourne, Kopenhagen, Hamburg, Paris) und öfters mit der Regisseurin Karoline Gruber (u.a. Leipzig, Düsseldorf, Wien). Mit Stefan Herheim erarbeitet er aktuell an der Deutschen Oper Berlin die ab 2020 angesetzte Neuinszenierung von Richard Wagners Ring des Nibelungen.
Während der Zeit der Corona-bedingten Schließung des Warburg-Hauses entfallen die Vorträge der Reihe zum Jahresschwerpunkt »Die Künste im technischen Zeitalter II« nicht, sondern werden im Lesesaal des Warburg-Hauses aufgezeichnet.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2019/20
Warburg-Haus: Die Künste im technischen Zeitalter II (Vortragsreihe, Di. 19 Uhr)
Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema „Die Künste im technischen Zeitalter“ anlässlich des Universitätsjubiläums 2019
In das Jahr 2019 mit seinem hundertjährigen Jubiläum der 1919 gegründeten Universität Hamburg fällt auch der 90. Todestag von Aby Warburg (1866-1929). In diesem Jahr rückt das Warburg-Haus Aby Warburg und die Geburt der modernen Kunstwissenschaft in Hamburg in den Fokus eines Veranstaltungs-Programms zum Universitätsjubiläum: „Die Künste im technischen Zeitalter«. Seit den 1920er Jahren spielte die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Kunstgeschichte und bei der Vernetzung der Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg. Mit der Eröffnung ihres Gebäudes in der Heilwigstraße 116 im Jahr 1926, dem seit 1995 wieder öffentlichen Warburg-Haus, hatte ihr Gründer Aby Warburg ihr auch einen auf interdisziplinären Austausch ausgerichteten institutionellen Ort gegeben. Die Hamburger Schule um Erwin Panofsky, Fritz Saxl, William S. Heckscher, Edgar Wind u.a. hat es, inspiriert durch die innovativen Impulse aus Warburgs kunsthistorischen Arbeiten und der mit ihnen durchgehend verbundenen Methodenreflexion, in Jahrzehnten produktiver Forschung – auch nach dem Londoner Exil der Bibliothek ab 1933 – zu Weltgeltung gebracht. Unter dem Thema „Kunst und Technik“ ist der Aktualität von Warburgs Ansatz bis ins 21. Jahrhundert nachzugehen. Das Universitätsjubiläum bietet den willkommenen Anlass, an die Rolle zu erinnern, die Aby Warburg und seine Familie, der Kreis der Wissenschaftler um Warburg beim Aufbau der Universität Hamburg gespielt haben – darunter insbesondere Erwin Panofsky, erster Ordinarius für Kunstgeschichte, und der Philosoph Ernst Cassirer, einer der ersten 1919 berufenen Professoren und Rektor der Universität im Amtsjahr 1929/1930. Im Fokus stehen auch die gegenwärtigen Projekte und Aktivitäten im Warburg-Haus, seine Archive und Forschungsstellen und sein wissenschaftliches und kulturelles Umfeld.
Nach der Auftaktveranstaltung mit einer Ausstellung und Performance der israelischen Künstlerin Hila Laviv im Oktober 2018 widmet sich die Vortragsreihe im ersten Halbjahr 2019 Warburgs Verhältnis zu Technologien, technischen Animationen im Film, Wahrnehmungsoptionen von Artefakten im Mittelalter im Licht der modernen Techniken Foto und Film sowie Musik und dem Klang im digitalen Zeitalter (Thomas Hensel, Gertrud Koch, Warburg-Professorin 2019 Barbara Schellewald, Rolf Goebel). Im Sommersemester führt ein Seminar Studierende in die Geschichte der Hamburger Schule ein. Die Vortragsreihe wird ergänzt durch thematische Stadtspaziergänge auf den Spuren von Ernst Cassirer, Aby Warburg und Fritz Schumacher, Hamburger Oberbaudirektor und Lehrer des Architekten des Warburg-Hauses Gerhard Langmaack (Birgit Recki, Karen Michels, Hermann Hipp). Besuche in Kooperation mit dem Denkmalverein Hamburg, Führungen für Studierende und interessierte Besucher, Filmvorführungen und weitere Veranstaltungen sowie ein Tag der offenen Tür im Juni 2019 mit einem Abendvortrag über Warburg und die Wissenschaft in Hamburg (Michael Diers) öffnen das Haus zur Stadt und laden dazu ein, seine Geschichte und seine Einrichtungen kennenzulernen.
Im zweiten Halbjahr befasst sich die Vortragsreihe mit Architektur als Technik am Beispiel des Petersdoms in Rom, mit affizierenden Techniken des Films und dem Hamburger Planetarium als Zweigstelle von Aby Warburgs K.B.W. (Pascal Dubourg Glatigny, Christiane Voss, Uwe Fleckner), und im Oktober erinnert ein Festvortrag an den 90. Todestag von Aby Warburg.
Hamburg für alle – aber wie? (Ringvorlesung, Di. 18–20 Uhr, ESA O 221)
Im Rahmen der Vortragsreihe „Hamburg für alle – aber wie?“
Koordination: Cornelia Springer
Inhaltliche Schwerpunkte im Studienprogramm „Hamburg für alle – aber wie?“ bilden u.a. folgende Themen:
- Ursachen von Wohnungs-/Obdachlosigkeit
- Armutsbekämpfung und Soziale Gerechtigkeit. Politik in der Verantwortung
- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Die Bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle als tragende Säule
- Unterstützungsstrukturen für Wohnungs- und Obdachlose. Haupt- und Ehrenamt Hand in Hand?
- Arbeitsplatz „Straße“ – Aufsuchende Soziale Arbeit für obdachlose Menschen in Hamburg
- Öffentliche Unterbringung von Obdachlosen und Winternotprogramm
- Wohnen als Menschenrecht! Housing First als Lösung?
- Soziale Stadtentwicklung in Hamburg?
- Alternative Wohnkonzepte für eine integrative Stadtentwicklung
- Armut und Gesundheit/Medizinische Versorgung für Obdachlose
- Lebenslagen von Straßenkindern und jungen Obdachlosen
- Lebenslagen von Frauen auf der Straße
- Arbeitsmigration und Obdachlosigkeit
- Wohnungs-/Obdachlosigkeit im internationalen Vergleich
Diese Inhalte werden durch Fachvorträge von Expert*innen aus Theorie und (vor allem!) Praxis eingeführt. Die Vortragsreihe ist als Kooperation mit verschiedenen außeruniversitären Einrichtungen und Partner*innen konzipiert. Es tragen Vertreter*innen staatlich und kirchlich getragener Einrichtungen im Hamburger Hilfesystem, aus Politik und Verwaltung, der Sozialen Arbeit, aus NGOs, Journalismus und Wissenschaft dazu bei, Haupt- und Ehrenamtliche – die selbst mit wohnungs- und obdachlosen Menschen arbeiten oder sich für sie engagieren.
Zu der Vorlesungsreihe wird noch ein Podcast aufgezeichnet. Diesen finden Sie hier.
1989 – Vom Ende des Kommunismus in Ostmitteleuropa und der Sowjetunion (Ringvorlesung, Mi. 16–18 Uhr, ESA W 221)
Im Rahmen der Vortragsreihe „1989: Vom Ende des Kommunismus in Osteuropa und der Sowjetunion“
Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner
Die Vorlesungsreihe betrachtet die friedlichen Revolutionen und den Sturz der kommunistischen Herrschaftssysteme in Mittelosteuropa/der Sowjetunion in kulturwissenschaftlicher Perspektive. Ziel ist es, das Ende des Kommunismus im Hinblick auf verschiedene mittelosteuropäische Staaten zu rekonstruieren. Im Mittelpunkt soll das Epochenereignis selbst und nicht so sehr seine Folgen stehen. Die einzelnen Vorträge gehen folgenden Fragen nach:
- Wer waren die Hauptakteure: Intellektuelle, Dissidenten, Reformkommunisten, Gewerkschafts- und Studierendenbewegungen oder „das Volk“?
- Welche politischen und kulturellen Konstellationen ermöglichten einen massenhaften zivilen Ungehorsam/Protest?
- Wie verhielten sich die alten Eliten? Welche Rolle spielten Intellektuelle und die Medien?
- Welche Ziele, Forderungen, Erwartungen waren mit dem gesellschaftlichen Umbruch verbunden?
- Welche Formen des Protests und des Widerstands zeichnen die weitgehend friedlichen Revolutionen von 1989 aus?
- Gibt es nationale Eigenlogiken der Revolutionen oder eine übergreifende transnationale Idee und Dynamik?
Die Vortragsreihe wurde von der Landezentrale für politische Bildung Hamburg, dem Nordost-Institut (IKGN e.V.) in Lüneburg sowie den Osteuropastudien Universität Hamburg gemeinsam konzipiert und organisiert.
Die Ringvorlesung wird auch im Rahmen des Allgemeinen Vorlesungswesen an der Universität Hamburg angeboten.
Andocken 18 – Hamburg-Mythen im 19. und 20. Jahrhundert (Vortragsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA K)
Im Rahmen der Vortragsreihe: „Entstehung, Wandlung und Ausstrahlung von HamburgMythen des 19. und 20. Jahrhunderts: Neue Perspektiven von Geschichtswissenschaft, Philosophie, Erziehungswissenschaft und Public History“
Koordination: Dr. Johanna Meyer-Lenz / Prof. Dr. Thorsten Logge / Dr. Markus Hedrich / Dr. Ralf Erik Werner
Lokale (Mikro-)Mythen und Erzählungen sind Narrative, die an spezifischen diskursiven Konstellationen entstehen und dazu beitragen, individuelle und kollektive Identitäten herzustellen. Die Ringvorlesung „Andocken 18: HamburgMythen im 19. und 20. Jahrhundert“ nähert sich in interdisziplinärer Perspektive dem Phänomen Hamburg über seine Erzählungen („Tor zur Welt“, „Sound des Hafens“, „Hamburg trägt den Pelz nach innen“) an, um die Diskursfigur „Hamburg“ über ihre narrative Tiefenschicht kulturwissenschaftlich zu erschließen. Der zentrale Begriff des Mythos wird die Reihe als roter Faden strukturieren. Die Ringvorlesung beginnt mit der Vorstellung des Mythen-Konzeptes Ernst Cassirers als umgreifendes Prinzip einer „mythischen Lebensform“ und „Einstellung des Bewusstseins auf die Wirklichkeit“ (Birgit Recki), um dann BildungsMythen in musealer Soundarchitektur und digitalen Erinnerungsmilieus in Hamburg-relevanten Games zu thematisieren.
Insgesamt widmet sich die Ringvorlesung der Metropole Hamburg mit ihren vielfältigen Mythen und Erzählungen. Diese sollen der Veranstaltungsreihe als kulturwissenschaftliche Sonde zur Vermessung der narrativen Essenz Hamburgs dienen. Dabei soll anhand Hamburgs immer auch die Frage im Zentrum stehen, wie urbane Mythen, Bedeutungen und Identitäten etwa durch Sounds, Texte und Architekturen kulturell gemacht, gewusst und produziert werden. Am Ende des Semesters steht eine Podiumsdiskussion, die eine Bilanz der Beiträge zum Thema HamburgMythen, ihren lokalisierten Identitäten, Diskursen und Traditionen zieht und dem Publikum Gelegenheit gibt, zentrale Fragen und Aspekte gemeinsam zu vertiefen.
Humboldt, und was nun? Kolonialismus, Raubkunst und die Zukunft der Museen (Vorlesungsreihe, unregelmäßige Termine, ESA C)
Im Rahmen der Vorlesungsreihe: „Humboldt, und was nun? Kolonialismus, Raubkunst und die Zukunft der Museen“
Koordination: Prof. Dr. Jürgen Zimmerer
Das Humboldt Forum im wiedererrichteten Berliner Stadtschloss sorgt seit einigen Jahren für intensive Diskussionen. Die geplanten Ausstellungen mit zahlreichen Objekten, die durch europäische Kolonialmächte geraubt wurden, stießen eine breite Debatte um die Aufarbeitung des Kolonialismus an. Angesichts von Restitutionsforderungen insbesondere aus Afrika steht seit einiger Zeit die Rolle von Museen in Deutschland, aber auch anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Belgien im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen.
In der Vorlesungsreihe werden einige der wichtigsten Beteiligten der Diskussionen der letzten Jahre zu Wort kommen. Anlässlich der 2020 anstehenden Eröffnung des Humboldt Forums werden sie ein Zwischenfazit ziehen sowie einen Ausblick wagen auf die Zukunft ethnologischer Museen und die globalen Debatten um Kolonialismus und Raubkunst.
Weitere Informationen sowie mögliche Änderungen übernehmen Sie bitte der Website der Forschungsstelle für Zeitgeschichte.
Go East – Go West! Transnationale und translinguale Identitäten zwischen Deutschland und Mittelosteuropa (Autorinnenlesung mit Dora Čechova, 20.11.2019, Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg)
Aus dem Projekt „Go East – Go West! Transnationale und translinguale Identitäten zwischen Deutschland und Mittelosteuropa“: Autorinnenlesung mit Dora Čechova
Organisation: Studierende des Instituts für Slavistik
Im Zentrum des literatur- und kulturwissenschaftlichen Projekts stehen sowohl die neusten theoretischen Ansätze in der Forschung zur transnationalen Literatur und Mehrsprachigkeit, als auch praxisbezogene Projektarbeit der Studierenden. Literarische Texte, die die Erfahrungen von Alterität, Identität und Transnationalität, von Mehrsprachlichkeit und Vielsprachlichkeit thematisieren, sollen dabei erforscht werden. Russische, polnische, tschechische sowie serbokroatische literarische Texte, die in klassischen und innovativen Lernformaten (Workshops, Schreibwerkstatt, Studierendenkonferenz) untersucht werden, sollen dabei als Grundlage für die Bestimmung der zentralen Themen und Motive von transnationaler Literatur dienen. Ziel des Projekts ist es, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich sowohl mit ihrem eigenen Migrationshintergrund wissenschaftlich und kreativ auseinanderzusetzen, als auch praktische Erfahrungen am universitären Betrieb zu sammeln.
Weiter Informationen zum Projekt finden Sie hier.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2019
Das Thai: Eine Tonsprache (Einzelvortrag von Prof. Dr. Volker Grabowsky, 21.05.2019, 14–16 Uhr, ESA K)
Im Rahmen der Ringvorlesung „Sprachen der Welt“
Koordination: Prof. Dr. Beáta Wagner-Nagy/ Hannah Wegener
Die Ringvorlesung stellt in bewährter Weise einzelne Sprachen oder Sprachgruppen, Sprachkontaktsituationen und sprachtypologische Befunde vor. Kolleginnen und Kollegen verschiedener Fachbereiche der Geisteswissenschaftlichen Fakultät werden jeweils als kultur- oder sprachwissenschaftliche Experten partizipieren. So wird – nicht zuletzt auch für Lehramtsstudierende – ein dichter und pointierter Überblick über die Sprachen der Welt exemplarisch möglich. Das Plakat der Ringvorlesung mit den weiteren Terminen finden Sie hier.
Kafkas letzter Prozess (Buchvorstellung mit Benjamin Balint, 23.04.2019, 20 Uhr, Jüdischer Salon im Café Leonar)
Der berühmteste Koffer der Literaturgeschichte hätte es beinahe nicht geschafft. Max Brod hatte ihn bei sich, als er 1939 mit dem letzten Zug von Prag nach Palästina floh. Im Koffer: Manuskripte, Notate, Kritzeleien seines Freundes Franz Kafka. Jahrzehnte später entspann sich darum ein Gerichtskrimi, der erst 2016 ein Ende fand. Vordergründig wurde über den Nachlass von Max Brod entschieden, doch standen noch ganz andere Fragen im Raum: War Kafka vor allem ein jüdischer Autor? Wo ist sein Erbe richtig aufgehoben? In Israel? Oder in jenem Land, in dessen Namen Kafkas Familie einst ausgelöscht wurde? Eine filmreife Geschichte, die nicht nur zeigt, weshalb die Frage, wem Kafka gehört, zum Glück nie entschieden werden kann.
In einer „meisterlichen Spurensuche“ (Cynthia Ozick) hat Benjamin Balint den ganzen Fall recherchiert, mit Prozessbeteiligten und Wissenschaftler*innen gesprochen, Gerichtsakten und Archivmaterial ausgewertet. Herausgekommen ist eine spannende Geschichte, die über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren von Prag nach Jerusalem führt und in ihren absurden Wendungen und unauflösbaren Widersprüchen selbst geradezu literarisch anmutet.
Benjamin Balint, geboren 1976 in den USA, lebt als Autor und Übersetzer aus dem Hebräischen in Jerusalem. Seine Kritiken und Essays erscheinen unter anderem in Die Zeit, Wall Street Journal, Ha’aretz und Weekly Standard. Kafkas letzter Prozess ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.
Gastgeber und Gesprächspartner ist Sebastian Schirrmeister (Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur, Universität Hamburg)
Sprachliche Vielfalt in der Geschichte und Gegenwart der Hansestadt (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, ESA Ost, Raum 221)
Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema „Sprachliche Vielfalt in der Geschichte und Gegenwart der Hansestadt“ anlässlich des Universitätsjubiläums 2019.
Koordination: Univ.-Prof. Dr. Jannis Androutsopoulos
Mehrsprachigkeit gehört zu Hamburg wie der Hafen und die Elbe. Durch ihre geografische Lage und Handelsprivilegien wurde die Hansestadt schon früh zu einem Knotenpunkt des internationalen Warenaustausches, aber auch zum Ort der Zuflucht und Ansiedlung für Menschen unterschiedlicher Herkunft. Die dadurch entstandenen Sprach- und Kulturkontakte prägen bis heute das Leben in Hamburg. Zum Spannungsfeld von Niederdeutsch und Hochdeutsch gesellten sich im Laufe der Zeit das Dänische, Portugiesische und Französische, die Sprachen der europäischen Juden und viele weitere Sprachen, bis zum globalen Englisch und den migrationsbedingten Sprachgemeinschaften der Gegenwart. Diese polyglotte Vielfalt war schon immer mit ökonomischer Prosperität eng verbunden und trägt zum kosmopolitischen Flair Hamburgs entscheidend bei. Mehrsprachigkeit stellt aber auch öffentliche Institutionen wie z. B. das Bildungs- und Gesundheitswesen vor große Herausforderungen, wenn es darum geht, einer hochgradig heterogenen Stadtbevölkerung Zugang zu Ressourcen und zur gesellschaftlichen Partizipation zu verschaffen. Diese Ringvorlesung versammelt ausgewiesene Expertinnen und Experten aus den Geistes-, Bildungs- und Sozialwissenschaften und repräsentiert die interdisziplinäre Mehrsprachigkeitsforschung an der Universität Hamburg. Die Vorträge bieten Einblicke in die kommunikative Geschichte und Gegenwart Hamburgs aus Sicht seiner wechselnden, nicht immer konfliktfreien Sprachverhältnisse und zeigen, wie eng Sprache mit dem städtischen Raum verbunden ist.
Die Ringvorlesung wird anlässlich des Universitätsjubiläums 2019 und im Rahmen des Jubiläumsprojekts LinguaSnappHamburg ausgerichtet.
100 Jahre Universität Hamburg (Vortragsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA C)
100 Jahre Universität Hamburg: Abschluss der fünfsemestrigen Veranstaltungsreihe im Jubiläumsjahr
Koordination: Prof. Dr. Rainer Nicolaysen / Dr. Gunnar B. Zimmermann
Das 100-jährige Bestehen unserer Universität bietet einen besonderen Anlass zur Beschäftigung mit ihrer Geschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart. Im Rahmen der umfangreichen Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2019 wird auch der erste Band einer vierbändigen Universitätsgeschichte erscheinen, die als multiperspektivische Darstellung übergreifende Fragestellungen zur Geschichte der Hamburger Universität behandeln sowie möglichst flächendeckend und quer durch alle Fakultäten die Geschichte einzelner Fächer präsentieren wird. Auch der fünfte und letzte Teil der Ringvorlesung bietet den zur Hamburger Universitätsgeschichte arbeitenden Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit, ihre Forschungsergebnisse einem breiten Publikum vorzustellen.
Die Vorlesungsreihe wird von der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte veranstaltet. Kooperationspartner sind der Verein für Hamburgische Geschichte (VHG) und der Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH).
Mehr Informationen und weitere Termine finden Sie hier.
Warburg-Haus (2019): Die Künste im technischen Zeitalter (Vortragsreihe, Di. 19 Uhr)
Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema „Die Künste im technischen Zeitalter“ anlässlich des Universitätsjubiläums 2019.
In das Jahr 2019 mit seinem hundertjährigen Jubiläum der 1919 gegründeten Universität Hamburg fällt auch der 90. Todestag von Aby Warburg (1866-1929). In diesem Jahr rückt das Warburg-Haus Aby Warburg und die Geburt der modernen Kunstwissenschaft in Hamburg in den Fokus eines Veranstaltungs-Programms zum Universitätsjubiläum: „Die Künste im technischen Zeitalter“. Seit den 1920er Jahren spielte die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Kunstgeschichte und bei der Vernetzung der Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg. Mit der Eröffnung ihres Gebäudes in der Heilwigstraße 116 im Jahr 1926, dem seit 1995 wieder öffentlichen Warburg-Haus, hatte ihr Gründer Aby Warburg ihr auch einen auf interdisziplinären Austausch ausgerichteten institutionellen Ort gegeben. Die Hamburger Schule um Erwin Panofsky, Fritz Saxl, William S. Heckscher, Edgar Wind u.a. hat es, inspiriert durch die innovativen Impulse aus Warburgs kunsthistorischen Arbeiten und der mit ihnen durchgehend verbundenen Methodenreflexion, in Jahrzehnten produktiver Forschung – auch nach dem Londoner Exil der Bibliothek ab 1933 – zu Weltgeltung gebracht. Unter dem Thema „Kunst und Technik“ ist der Aktualität von Warburgs Ansatz bis ins 21. Jahrhundert nachzugehen. Das Universitätsjubiläum bietet den willkommenen Anlass, an die Rolle zu erinnern, die Aby Warburg und seine Familie, der Kreis der Wissenschaftler um Warburg beim Aufbau der Universität Hamburg gespielt haben – darunter insbesondere Erwin Panofsky, erster Ordinarius für Kunstgeschichte, und der Philosoph Ernst Cassirer, einer der ersten 1919 berufenen Professoren und Rektor der Universität im Amtsjahr 1929/1930. Im Fokus stehen auch die gegenwärtigen Projekte und Aktivitäten im Warburg-Haus, seine Archive und Forschungsstellen und sein wissenschaftliches und kulturelles Umfeld.
Nach der Auftaktveranstaltung mit einer Ausstellung und Performance der israelischen Künstlerin Hila Laviv im Oktober 2018 widmet sich die Vortragsreihe im ersten Halbjahr 2019 Warburgs Verhältnis zu Technologien, technischen Animationen im Film sowie Musik und dem Klang im digitalen Zeitalter (Thomas Hensel, Gertrud Koch, Rolf Goebel). Im Sommersemester führt ein Seminar Studierende in die Geschichte der Hamburger Schule ein. Die Vortragsreihe wird ergänzt durch thematische Stadtspaziergänge auf den Spuren von Ernst Cassirer, Aby Warburg und Fritz Schumacher, Hamburger Oberbaudirektor und Lehrer des Architekten des Warburg-Hauses Gerhard Langmaack (Birgit Recki, Karen Michels, Hermann Hipp). Besuche in Kooperation mit dem Denkmalverein Hamburg, Führungen für Studierende und interessierte Besucher, Filmvorführungen und weitere Veranstaltungen sowie ein Tag der offenen Tür im Juni 2019 mit einem Abendvortrag über Warburg und die Wissenschaft in Hamburg (Michael Diers) öffnen das Haus zur Stadt und laden dazu ein, seine Geschichte und seine Einrichtungen kennenzulernen.
Im zweiten Halbjahr befasst sich die Vortragsreihe mit Architektur als Technik am Beispiel des Petersdoms in Rom, mit affizierenden Techniken des Films und dem Hamburger Planetarium als Zweigstelle von Aby Warburgs K.B.W. (Pascal Dubourg Glatigny, Christiane Voss, Uwe Fleckner), und im Oktober erinnert ein Festvortrag an den 90. Todestag von Aby Warburg.
Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten des Warburg-Hauses.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2018/19
1918/19 - Auf/Brüche in Osteuropa (Ringvorlesung, Mi. 16–18 Uhr, ESA West, Raum 221)
Im Rahmen der Vorlesungsreihe „1918/19 - Auf/Brüche im östlichen Europa“
Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner
Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 ging die imperiale Ordnung des 19. Jahrhundert zu Ende. Der Zerfall der drei großen Imperien - Österreich-Ungarn, zarisches Russland und Osmanisches Reich, die die Geschicke Mittel- und Osteuropas bestimmt hatten, hinterließ ein machtpolitisches Vakuum. Für die Völker im östlichen Europa bedeutete das Ende der Imperien den Aufbruch in eine neue politische, gesellschaftliche und kulturelle Ordnung, vor allem aber in die staatliche Unabhängigkeit. Die 1918/19 (wieder)erlangte Staatlichkeit wird heute, 100 Jahre danach, von Prag bis Tallinn, von Warschau bis Belgrad gefeiert.
Die Ringvorlesung bietet eine breite Auseinandersetzung mit den Ereignissen 1918/19 und seinen Folgen aus der Perspektive verschiedener Fachbereiche wie Geschichte, Literatur- und Politikwissenschaft. Die Vortragenden widmen sich in ihren Beiträgen den Prozessen, die vor 100 Jahren im östlichen Europa ihren Anfang nahmen und deren langfristigen Auswirkungen sowohl für einzelne Länder als auch für die gesamte Region, wobei ein besonderer Fokus auf nationale Minderheiten gelegt wird.
Die Vortragsreihe wurde von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, dem Nordost-Institut (IKGN e.V.) in Lüneburg sowie den Osteuropastudien Universität Hamburg gemeinsam konzipiert und organisiert.
Weitere Termine:
Mittwoch, 09. Januar 2019, 16:15 - 17.45 Uhr
Erinnerung als Zukunft: Die Konstruktion der jugoslawischen Nation nach 1918
Prof. Dr. Janine-Marie Calic, Historisches Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München
Mittwoch, 16. Januar 2019, 16:15 - 17:45 Uhr
Der Einfluss historischer Entwicklungen und regionaler Strukturen auf die Wahlentscheidung in Polen
Dr. Kamil Marcinkiewicz, Politikwissenschaft, Universität Hamburg
Mittwoch, 23. Januar 2019, 16:15 - 17:45 Uhr
Lemberg, Czernowitz und danach. Der große Krieg macht die Städte zu
Juri Andruchowytsch, Schriftsteller, Ivano-Frankivsk
Mahatma Gandhi: The Man, the Politician, the Icon (Vorlesungsreihe von Dr. Bidyut Chakrabarty, Do. 18–20 Uhr, ESA Ost, Raum 221)
A special lecture series in six parts by Dr. Bidyut Chakrabarty, Vice Chancellor, Visva Bharati University
As a guest at Hamburg University, Professor Bidyut Chakrabarty from the Visva Bharati University will lecture on the life and legacy of Mahatma Gandhi. Professor Chakrabarty has published widely on Gandhi and counts as one of the world’s foremost experts on Gandhi as a freedom fighter, politician and icon for nonviolent struggle.
Popularly known as Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948) stood out for being a stern proponent of nonviolence (ahimsa). Although he mobilized the colonized against the colonizers for political freedom, his main objective was to bring about human emancipation which involved freedom from exploitation, denigration and prejudices. By developing a contextual politicoideological design, he also demonstrated how nonviolence could be an effective mobilizing tool since nonviolence, he believed, was instinctive of human beings. It is true that Gandhi evolved a political template, based on nonviolence, which he derived from multiple Western and non-Western sources. Of all the thinkers who significantly influenced Gandhi in developing satyagraha (nonviolent struggle in Gandhi’s lexicon), Leo Tolstoy, John D Ruskin, Henry David Thoreau, Edward Carpenter, among others, were prominent; their ideas not only resonated in Gandhi’s socio-political idioms, they were critical to his conceptualization of an alternative mode of political struggle in which violence was a clear anathema.
Along with the Western intellectual antecedents, Gandhi was also indebted to his illustrious colleagues in India’s nationalist campaign against the British. Prominent among them were the communist MN Roy, the humanist Rabindranath Tagore, and BR Ambedkar who is credited with the framing of a liberal constitution for independent India.
As an activist-theoretician, Gandhi translated his ideological commitment to nonviolence into practice when he fought with British colonialism primarily because it deviated from the core values of the philosophy of Enlightenment which entailed benevolence, tolerance and compassion. Apart from leading three regional anti-British campaigns in Gujarat and Bihar, the Mahatma also organized three major pan-Indian onslaughts on the British 1921–22, 1930–32, and in 1942. Except in 1942, in the context of the Open Rebellion, both the past movements were strictly nonviolent and in case of the 1921–22 Noncooperation Movement, it was withdrawn when violence occurred that culminated in the killing of police officials in Uttar Pradesh. India won independence in 1947 and the nonviolent
campaign that Gandhi spearheaded had played a critical role. It was an example that inspired many to resort to nonviolence to fight oppression and for liberty, equality and fraternity. Gandhi thus became a global icon who seems to have crafted a specific politico-ideological design for transformation. Examples are many, though this lecture series will focus on the nonviolent civil rights campaign in the US by Martin Luther King Jr., the movement in Germany by Petra Kelly which drew on nonviolence, and Nelson Mandela’s nonviolent challenge against the apartheid regime in South Africa.
What is thus distinctive about Gandhi was his ability to evolve an ideological response on the basis of a creative blending of messages from multiple religious traditions. A global icon, Mahatma Gandhi thus carried forward a legacy for which Buddha left the worldly comfort, Mahavira of Jainism sacrificed everything worldly, and Jesus Christ allowed himself to be crucified. His effort was thus a
continuity of a trend representing transcendental ethos and values.
Die Novemberrevolution 1918/19, Teil 2 (Ringvorlesung, Mi. 18–20 Uhr, Museum für Hamburgische Geschichte)
Im Rahmen der Vorlesungsreihe: „Andocken 17 - Novemberrevolution 1918/19, Teil 2“
Koordination: Dr. Johanna Meyer-Lenz
Im zweiten Teil der Vorlesungsreihe leuchten Historikerinnen und Historiker das epochale Drama der Novemberrevolution von 1918/19 für Hamburg und Norddeutschland in einzelnen Aspekten aus, die zum Teil noch sehr jungen Forschungen entstammen. Durch die Auswahl der Beiträge werden Extreme thematisiert. Auf der politischen und gesellschaftlichen Bühne werden Vertreter der Elite des konservativen Bürgertums und der Wirtschaft Hamburgs in ihren Haltungen zur Revolution vorgestellt; sie werden kontrastiert mit der Vielstimmigkeit von Akteurinnen und Akteuren aus der Arbeiterschaft und aus der Mittelschicht. Träume, Pläne, Illusionen, Gegenstrategien, all dies fließt hier zusammen. Ebenso wird der Blick auf das Geschehen in der benachbarten Stadt Altona wie auf das Geschehen im Umland Hamburgs ausgeweitet.
Straßenproteste auf der einen Seite, Untergangsstimmung auf der anderen, Versuche des konstruktiven Aufbaus einer demokratischen bis sozialistischen Gesellschaft, all dies ergibt ein Kaleidoskop von Eindrücken, die das Revolutionsgeschehen und die weitere Entwicklung Hamburgs bis in den Beginn der Weimarer Republik kennzeichnen.
Manche festgefahrenen Vorstellungen geraten durch die neueren und neuesten Forschungen wieder in Fluss. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Erinnerungskultur an die Revolution und an Weimar? Diese und andere Fragen möchten die Veranstalter*innen mit dem Publikum diskutieren.
Die Vorlesungsreihe wird gefördert vom Förderverein des Kontaktstudiums für ältere Erwachsene.
Mittwoch, 24. Oktober 2018, 16 - 17.30 Uhr
Lokale Ordnungen: Streiks, Straßenproteste und Gewaltkommunikation in Hamburg (1916-1923).
Prof. Dr. Klaus Weinhauer, Historiker, Fakultät für Geschichtswissenschaft Universität Bielefeld
Mittwoch, 14. November 2018, 16 - 17.30 Uhr
Das Ende Albert Ballins - das Ende einer Epoche?
Dr. Johanna Meyer-Lenz, FKGHH Hamburg Universität Hamburg
Varieties of Relevance (Workshop, Fr. 12.10.2018, ESA)
Im Rahmen der Konferenz „Varieties of Relevance“
Gerhard Schurz: Relevace in the Theory of Confirmation
Relevance requirements are vital for every viable theory of confirmation. My analysis starts from a probabilistic account of confirmation including hypothetico-deductive confirmation as a subcase. Going beyond the ordinary Bayesian accounts it is shown that in order to discriminate genuine confirmation from pseudo-confirmation it is necessary to apply relevance requirements to content parts of the hypothesis to be confirmed. In the final part it is illustrated how the proposed relevance criteria can be seen as applications of the so-called replacement account of relevance.
Warburg-Haus 2018: Politische Emotionen (Vortragsreihe, Di. 19 Uhr)
Vortrag des Trägers des Wissenschaftspreises der Aby-Warburg-Stiftung 2018 im Rahmen der Vortragsreihe „Politische Emotionen“
Angst, Sorge, Empörung oder Verachtung, aber auch Vertrauen, Hoffnung, Mitleid, Empathie oder Sympathie werden momentan als politische Kräfte verstärkt diskutiert. Über die zentrale Rolle von Emotionen in politischen Prozessen scheint man sich zwar einig zu sein: Sie gelten als Movens sowohl von Protestbewegungen als auch als Faktor in demokratischen Meinungsbildungsprozessen, sie scheinen den Zusammenhalt politischer Gebilde zu garantieren, sie sind verantwortlich für massenpsychologische Phänomene wie Umsturz und Revolution oder für das Kippen dieser Bewegungen in Terror und Schrecken. Die Einschätzungen des Phänomens divergieren indes beträchtlich. Während die einen den Mangel an „politischer Leidenschaft“ bedauern, warnen andere vor Hysterie, vor „Wutbürgern“ und vor einer emotionsgesteuerten Politik. Sind „Gefühlspolitiken“ also legitim oder wäre vielmehr generelle Skepsis gegenüber emotionalen Überwältigungsstrategien geboten? Sollen und können politische Entscheidungen überhaupt rational getroffen werden, oder sind Emotionen aus der Politik schlicht nicht wegzudenken?
Der Diskussion dieser Fragen bietet der Themenschwerpunkt „Politische Emotionen“ am Warburg-Haus Raum. Die Vortragsreihe im ersten Halbjahr 2018 widmet sich der politischen Gefühlskultur in der Demokratie, dem Mitgefühl und gesellschaftlichen Affektlagen im Krieg (Hans-Peter Krüger, Sigrid Weigel und Alexander Honold). Die Vortragsreihe wird von Kooperationsveranstaltungen zur Darstellung und Rolle von Emotionen in Film, Medien, Literatur und Künsten flankiert. Den Abschluss des ersten Halbjahrs bildet im Juli 2018 ein Thementag zur kulturellen Wahrnehmung von (Natur-)Katastrophen, den das Warburg-Haus in Kooperation mit der Forschungsstelle Naturbilder der Universität Hamburg an der Hamburger Kunsthalle veranstaltet. Das Internationale Warburg-Kolleg widmet sich im Oktober 2018 „Politischen Emotionen in den Künsten“: Von welchen Ikonographien zehren aktuelle Emotionspolitiken, welchen längst kodierten Dramaturgien folgen soziale Bewegungen, welche bekannten Narrative der Mobilisierung oder Eindämmung politische Emotionen werden aufgegriffen?
Die Vortragsreihe im zweiten Halbjahr 2018 thematisiert mediale und digitale Repräsentationen emotionaler Affekte: Betrachtet werden das Genrekino als Erfahrungsraum von Gemeinschaftssinn (Hermann Kappelhoff), Emotionalisierungsprozesse im Journalismus (Irene Neverla) und politisch-ikonologische Strategien im Zeitalter des Internet-Memes (Andrea Pinotti).
Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten des Warburg-Hauses.
Die Welten der Islamwissenschaft – Experten ohne Schwert (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, ESA Ost, Raum 221)
Im Rahmen der Vorlesungsreihe „Die Welten der Islamwissenschaft – Experten ohne Schwert“
Koordination: Vertr.-Prof. Dr. Schirin Fathi, Asien-Afrika-Institut, Islamwissenschaft, Universität Hamburg
Islamwissenschaft als Studienfach, Disziplin und Berufsbild ist für viele immer noch nicht klar umrissen. Wird man zum Theologen ausgebildet oder jagt man eher Salafisten? Geht man in die Politikberatung oder ist man journalistisch tätig? Und welches Territorium umfasst „Islamwissenschaft“? Und welchen Zeitraum? All dies sind legitime Fragen, auf die diese Ringvorlesung – zumindest schlaglichtartig – einige Antworten geben möchte. Das Seminar für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients – wie es noch bis zur Fusion mit den übrigen im Fachbereich Orientalistik angesiedelten Instituten und Gründung des Asien-Afrika-Instituts (AAI) im Jahr 2000 hieß – hat inhaltlich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen erlebt, je nach Interessensgebiet der Lehrstelleninhaber.
Aber eine Konstante gab es über die vergangenen 32 Jahre: Karin Hörner (1954 - 2018). Sie war nicht nur die Bibliothekarin des Seminars und ab 2002 die Leiterin der Bibliothek des AAI, sondern sie hat sich auch immer wissenschaftlich und inhaltlich eingebracht. So zum Beispiel in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Feindbild, der Kritik an sogenannten Islamexperten in den deutschen Medien und dem Themenkomplex Verschwörungstheorien. Und in Zeiten personeller Engpässe übernahm Karin Hörner weitere Aufgaben und zeigte großes Engagement auch für studentische Belange, ein Engagement das weit über ihre Pflichten hinausging. Diese Ringvorlesung findet in Gedenken an die geschätzte, langjährige Kollegin als Würdigung und Ehrung statt. Fast alle Vortragenden sind Absolventen der Abteilung für Geschichte und Kultur des Vorderen Orients der Universität Hamburg und zeigen somit nicht nur die Bandbreite unterschiedlicher Interessen und Berufsausübungen im Fach Islamwissenschaft sondern sie zollen auch der langjährigen Mitarbeiterin Respekt.
Weitere Veranstaltungen
29.10.2018
„Irgendwas mit Medien. Warum ich doch Fotojournalist geworden bin“
Lutz Jäkel, M.A., Foto-, Videojournalist, Autor, Berlin
05.11.2018
Kunst und Konflikt: Bedeutung von Hymnen und Gedichten für die islamistische Bewegung
Dr. Behnam Said, Buchautor, Hamburg
12.11.2018
Flucht- und Wanderbewegungen innerhalb und außerhalb des Irak am Beispiel der Christen, Jesiden und Schabak
Irene Dulz, M.A., Beraterin, GIZ, Dohuk/Irak
19.11.2018
Geschichte(n) erzählen: Frühislamische Historiografie und ihre zeitgenössische Relevanz
Dr. Hannah-Lena Hagemann, Asien-Afrika-Institut, Islamwissenschaft, Universität Hamburg
26.11.2018 - Vortrag entfällt
Von Toleranz für Ambiguität zur Ambiguität der Toleranz
PD Dr. Abbas Poya, Department Islamisch-Religiöse Studien, Universität Erlangen-Nürnberg
28.11.2018 (Mittwoch)
Motiv, Vor-Bild und Bild. Die Berliner Diez-Alben aus iranischen Künstlerateliers des 14./15. Jahr-
hunderts
Prof. Dr. Claus-Peter Haase, ehem. Direktor Museum für Islamische Kunst in Berlin
03.12.2018
Die marokkanische Anti-Terrorismus-Strategie
Olaf Kellerhoff, M.A., Projektleiter Marokko / Algerien, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Rabat (Marokko)
10.12.2018
Zwischen Diplomatie, Hochleistungssport und Pedanterie: Aus dem Leben einer Dokumentationsjournalistin
Dr. Claudia Stodte, SPIEGEL-Dokumentarin und Autorin, Hamburg
17.12.2018
Prävention ganzheitlich umsetzen – Hamburgs Konzept zur Vorbeugung und Bekämpfung von
religiös begründeter Radikalisierung und Muslimfeindlichkeit
Eleonore Yassine, M.A., Fachreferentin, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Hamburg
07.01.2019
„Der Terror ist zu wichtig, ihn den Terroristen zu überlassen“– wie Syriens Regime mitgeschaffen hat, was es zu bekämpfen vorgibt
Christoph Reuter, M.A., SPIEGEL-Korrespondent, Beirut
14.01.2019
Wie eine Islamdebatte funktioniert. Kleine Handreichung aus der Sicht eines Zeitungsjournalisten
Christian H. Meier, M.A., Politikredakteur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main
21.01.2019
Von der Orientalistik zu den MENARegionalwissenschaften. Geschichte und Perspektiven eines
disziplinären Feldes
Dr. Achim Rohde, Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, Goethe-Universität, Frankfurt am Main
28.01.2019
Dialogische Pfade oder Impressionen einer islamwissenschaftlichen Grenzgängerin
Dr. Ursula Günther, Arbeitsstelle Ökumene, interkulturelle Kirche, Kirchenkreis Hamburg-Ost
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2018
Warburg-Haus 2018: Politische Emotionen (Vorlesungsreihe, Di. 19 Uhr)
Im Rahmen der Vortragsreihe zum Schwerpunktthema „Politische Emotionen"
Angst, Sorge, Empörung oder Verachtung, aber auch Vertrauen, Hoffnung, Mitleid, Empathie oder Sympathie werden momentan als politische Kräfte verstärkt diskutiert. Über die zentrale Rolle von Emotionen in politischen Prozessen scheint man sich zwar einig zu sein: Sie gelten als Movens sowohl von Protestbewegungen als auch als Faktor in demokratischen Meinungsbildungsprozessen, sie scheinen den Zusammenhalt politischer Gebilde zu garantieren, sie sind verantwortlich für massenpsychologische Phänomene wie Umsturz und Revolution oder für das Kippen dieser Bewegungen in Terror und Schrecken. Die Einschätzungen des Phänomens divergieren indes beträchtlich. Während die einen den Mangel an „politischer Leidenschaft“ bedauern, warnen andere vor Hysterie, vor „Wutbürgern“ und vor einer emotionsgesteuerten Politik. Sind „Gefühlspolitiken“ also legitim oder wäre vielmehr generelle Skepsis gegenüber emotionalen Überwältigungsstrategien geboten? Sollen und können politische Entscheidungen überhaupt rational getroffen werden, oder sind Emotionen aus der Politik schlicht nicht wegzudenken?
Der Diskussion dieser Fragen will der Themenschwerpunkt „Politische Emotionen“ am Warburg-Haus Raum bieten. Die Vortragsreihe im ersten Halbjahr 2018 widmet sich der politischen Gefühlskultur in der Demokratie, dem Mitgefühl und dessen dunklen Seiten sowie gesellschaftlichen Affektlagen im Krieg (Hans-Peter Krüger, Sigrid Weigel, Fritz Breithaupt und Alexander Honold). Die Vortragsreihe wird von Kooperationsveranstaltungen zur Darstellung und Rolle von Emotionen in Film, Medien, Literatur und Künsten flankiert. Den Abschluss des ersten Halbjahrs bildet im Juli 2018 ein Thementag zur kulturellen Wahrnehmung von (Natur-)Katastrophen, den das Warburg-Haus in Kooperation mit der Forschungsstelle Naturbilder der Universität Hamburg an der Hamburger Kunsthalle veranstaltet. Das diesjährige Internationale Warburg-Kolleg wird sich im Oktober 2018 „Politischen Emotionen in den Künsten“ widmen: Von welchen Ikonographien zehren aktuelle Emotionspolitiken, welchen längst kodierten Dramaturgien folgen soziale Bewegungen, welche bekannten Narrative der Mobilisierung oder Eindämmung politische Emotionen werden aufgegriffen? Die Vortragsreihe im zweiten Halbjahr 2018 wird sich schließlich mit medialen und digitalen Repräsentationen politischer Affekte befassen (Hermann Kappelhoff, Irene Neverla, Eva Illouz und Andrea Pinotti).
26.04.2018
Zur politischen Gefühlskultur in der Demokratie
Prof. Dr. Hans-Peter Krüger, Universität Potsdam
15.05.2018
Vom Mitgefühl
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Sigrid Weigel, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin
02.07.2018
Rausch, Taumel, Schicksalsergebenheit: Im Planetarium des Krieges
Prof. Dr. Alexander Honold, Universität Basel
Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten des Warburg-Hauses.
Linguistic landscape: Sprachliche Vielfalt im öffentlichen Raum (Vorlesungsreihe, Di. 12.06.2018)
Gastvortrag „Linguistic Landscapes in Manchester“
Die Vorlesung „Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit“ vermittelt Grundbegriffe, Ansätze, Methoden und Ergebnisse der soziolinguistisch orientierten Mehrsprachigkeitsforschung. Mehrsprachigkeit, seit Mitte des 20. Jh.s. ein Thema der empirischen Linguistik, hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Grund hierfür sind sowohl gesamtgesellschaftliche Wandelprozesse wie Globalisierung, Mobilität und Mediatisierung, die mehrsprachige Kommunikation allgegenwärtig werden lassen, als auch fachinterne Diskurse, die in neuen Begriffen und Fragestellungen ihren Ausdruck finden.
Die Vorlesung greift dieses Spannungsverhältnis zwischen Sprachenvielfalt in der heterogenen Gesellschaft und fachimmanenten Debatten auf und vertieft sie exemplarisch in Theorie und Empirie. Die Vorlesung erläutert Kernbegriffe der neueren Mehrsprachigkeitsforschung wie u.a. Ressourcen und Praktiken, Räume, Sprachideologien, Polylingualität (polylingualism), Metrolingualität (metrolingualism) und Translingualität (translanguaging). Der empirische Gegenstandsbereich der soziolinguistischen Mehrsprachigkeitsforschung umfasst alltägliche Praktiken der mehrsprachigen Kommunikation im weitesten Sinne, einschließlich ihrer schriftlichen und medialen Spielarten. Anders als in der Bilingualismusforschung steht nicht eine atomistische, vom sozialen und interaktionalen Kontext losgelöste Kompetenz im Mittelpunkt, sondern eine in der mehrsprachigen Performanz konstituierte kommunikative Kompetenz, und im Gegensatz zur Kontaktlinguistik stehen nicht Sprachsysteme im Mittelpunkt, sondern Sprecher/innen mit ihren mehrsprachigen Ressourcen und Praktiken. Methodisch setzen wir uns u.a. mit Verfahren der linguistischen Ethnographie, der Sprachbiographie-Forschung und der digitalen Sprachanalyse auseinander. Ein Schwerpunkt dieser Vorlesung ist das Thema Linguistic Landscapes und die empirische Dokumentation sichtbarer Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit dem aktuellen Projekt LinguaSnappHamburg.
Die Novemberrevolution 1918/19, Teil 1 (Ringvorlesung, Mi. 18–20 Uhr, Museum für Hamburgische Geschichte)
Im Rahmen der Vortragsreihe „Revolution? Revolution! Die Novemberrevolution 1918/19 in Hamburg und in Norddeutschland“
„Revolution“, so schrieb Eric J. Hobsbawm 1994 „war das Kriegskind des 20. Jahrhunderts.“ Am dem Ende des Ersten Weltkrieges führte die Novemberrevolution von 1918/19 zum Zusammenbruch des Wilhelminischen Untertanenstaates („Die Zeit“, 4.1.2018).
Norddeutschland lag mit dem Ausbruch der Revolution in Kiel am 4./5.November 1918 im Zentrum des Geschehens, am 5./6. 11. 1918 wehte die rote Fahne der Revolution in Hamburg. Das Ende des unmittelbaren Revolutionsgeschehens in Hamburg im März 1919 mit dem Übergang zu eine demokratischen parlamentarischen Republik war noch nicht das Ende von Unruhen und Revolten in Hamburg. Diese Zeit des Umbruchs und des Übergangs, die „vergessene“ Revolution in Hamburg wird erstmals anlässlich des 100. Jahrestages der Revolution in einer Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte präsentiert. Die Ringvorlesung wird diese „Geburtsstunde eines neuen Hamburg“, die Szenerie dieses epochalen Dramas der Novemberrevolution von 1918/19 für Hamburg und Norddeutschland im Lichte der Ergebnisse neuerer Forschungen beleuchten.
02.05.2018
Die ungeliebte Revolution
Dr. Kirsten Heinsohn, Universität Hamburg
06.06.2018
1918/19: zwei Revolutionen in Hamburg? Politik, Militär und Hungerrevolten von November 1918 bis Juli 1919
Uwe Schulte-Varendorff
1968 in Osteuropa: Reformen und Gegenbewegungen (Ringvorlesung, Mi. 18–20 Uhr, Hörsaal der StaBi)
März 1968 in Polen: Studentische Proteste und antisemitische Kampagne
Koordination: Renata Rakoczy-Dahlmann
Das Jahr 1968 war in Osteuropa ein Jahr voller dramatischer Ereignisse, verbunden mit großen politischen Hoffnungen und großen Enttäuschungen. Doch in Deutschland ist die Erinnerung an 1968 bis heute vor allem durch die Studentenproteste in den westlichen Ländern geprägt. Was in den sozialistischen Ostblockstaaten passierte ist, abgesehen von den Ereignissen in Prag, weniger bekannt.
Auch in Osteuropa war 1968 ein Jahr des Aufbruchs. Liberale Kräfte der kommunistischen Parteien in der ČSSR und in Ungarn wollten politische und wirtschaftliche Reformen erreichen, in Polen probten demokratische Kräfte den Aufstand gegen das autoritäre System und Studenten demonstrierten für mehr Freiheit.
Wie war die Atmosphäre dieser Zeit in der ČSSR? Worin bestanden die Reformbemühungen in Ungarn? Warum entluden sich die Ereignisse in Warschau in einer antisemitischen Kampagne? Am Beispiel dieser drei Länder blickt die Reihe aus der Perspektive der Osteuropastudien auf das Jahr 1968.
Näheres zu den einzelnen Vorträgen finden Sie unter: https://www.slm.uni-hamburg.de/osteuropastudien/forschung/tagungen-veranstaltungen/vortragsreihe-zu-1968.html.
13.06.2018
März 1968 in Polen: Studentische Proteste und antisemitische Kampagne
Dr. Hans-Christian Dahlmann, Hamburg
20.06.2018
Der wirtschaftliche Frühling in Osteuropa
Dr. Magdalena Pajor-Bytomski, Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg
27.06.2018
Panzer in Prag. Der fotografische Blick auf die Invasion von 1968
Prof. Dr. Martina Winkler, Historisches Seminar/Abteilung für Osteuropäische Geschichte an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel
Pazifismus und Buddhismus (Ringvorlesung, Do. 18–20 Uhr, ESA Ost 221)
Im Rahmen der Vorlesungsreihe „Zwischen Ideal und Wirklichkeit: Perspektiven aus Ost und West“
Koordination: Prof. Dr. Steffen Döll / Prof. Dr. Michael Zimmermann, beide Asien-Afrika-Institut, Numata Zentrum für Buddhismuskunde, Universität Hamburg / Birgit Stratmann, Netzwerk "Ethik Heute"
Der Pazifismus ist eine ethische Grundhaltung, die Krieg und Gewaltanwendung ablehnt. Heute macht der Begriff des „aufgeklärten Pazifismus“ die Runde, der militärische Interventionen unter bestimmten Bedingungen erlaubt, ja sogar fordert. Wie sieht es in den Religionen, insbesondere im Buddhismus aus? Fördern sie Friedensliebe oder Gewaltanwendung?
Kriege, Bürgerkriege und Terror stellen die globale Gesellschaft heute vor enorme Herausforderungen. Das ethische Dilemma lässt sich dabei auf die Frage hin zuspitzen: Müssen Staaten in Fällen von massiver kollektiver Gewaltanwendung eingreifen? Oder aber ist jeglicher Einsatz von Gewalt abzulehnen, insofern er – um nur eine mögliche Argumentationslinie aufzugreifen – eine Gewaltspirale provoziert?
Im Buddhismus ist das Ideal der Gewaltlosigkeit verbreitet. Damit wird jegliche Form der Gewaltausübung auf individueller Ebene prinzipiell abgelehnt. Ein politischer Pazifismus ist dort jedoch nicht auszumachen. Zudem wird – durchaus kontrovers und mit deutlichen Verschiebungen, was Zeit und Ort solcher Aushandlungen angeht – diskutiert, ob nicht buddhistische Herrscher unter Umständen die Pflicht hätten, unter Zuhilfenahme von physischer und militärischer Gewalt zu intervenieren.
Die Vortragsreihe wirft ein Schlaglicht auf pazifistische Strömungen in Ost und West und möchte einen Beitrag zu dieser wichtigen gesellschaftlichen Diskussion leisten.
19.04.2018
Die Moral des Krieges
Prof. Dr. Wilfried Hinsch, Philosophisches Seminar, Arbeitsbereich Praktische Philosophie, Universität zu Köln
10.05.2018
Buddhismus – Stimmt das Image der Friedfertigkeit?
Prof. Dr. Michael Zimmermann, Asien-Afrika-Institut, Numata Zentrum für Buddhismuskunde, Universität Hamburg
31.05.2018
Zen-Buddhismus – Aspekte von Gewalt und Frieden
Prof. Dr. Inken Prohl, Institut für Religionswissenschaft, Universität Heidelberg
14.06.2018
Buddhismus – Stimmt das Image der Friedfertigkeit?
Prof. Dr. Michael Zimmermann, Asien-Afrika-Institut, Numata Zentrum für Buddhismuskunde, Universität Hamburg
28.06.2018
Pazifismus – die Ausnahme in Religion und Staat. Beispiele aus Sri Lanka und Myanmar
Prof. Peter Schalk, Ph.D., Department History of Religions, Uppsala Universit
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2017/18
Warburg-Haus 2017: Latenz in den Künsten (Vorlesungsreihe, Di. 19 Uhr)
Aby Warburg
Interdisziplinäres Forum für Kunst- und Kulturwissenschaften
Koordination: Dr. Katharina Hoins
Das Hamburger Warburg-Haus versteht sich als Impulsgeber in einer lebendigen Hamburger Wissenschaftslandschaft. Als Einrichtung der Universität Hamburg und der Aby-Warburg-Stiftung sowie gefördert von der Hamburger Behörde für Wissenschaft und Forschung widmet es sich geistes- und kulturgeschichtlicher Spitzenforschung und wirkt gleichzeitig durch die gesellschaftspolitische Relevanz seiner Themen und Methoden in die Öffentlichkeit hinein.
Es sieht sich seiner Geschichte und der Tradition von Forscherpersönlichkeiten wie Aby Warburg, Erwin Panofsky und Ernst Cassirer verpflichtet und erhebt den Anspruch, den wissenschaftlichen Aufbruch dieser Gründergeneration der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg für die Forschungsherausforderungen der Gegenwart zu aktualisieren. Leitgedanke ist die Weiterentwicklung und kritische Reflexion der interdisziplinären Kunst- und Kulturforschung, wie sie von Warburg und seinem Kreis programmatisch entwickelt wurde.
In unregelmäßigen Abständen zeichnet das eLearning-Büro der Fakultät für Geisteswissenschaften einzelne Vorträge im Warburg-Haus auf. Für kommende Termine besuchen Sie bitte die Homepage des Warburg-Hauses unter: http://www.warburg-haus.de/.
24.10.2017
„Dream on, dream on, of bloody deeds and death“: Alptraum und Geschichte in Shakespeares Richard III
Prof. Dr. Martin von Koppenfels, LMU München
21.11.2017
Saussure, der Text, die Bilder
Prof. Dr. Anselm Haverkamp, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
19.12.2017
Hermiones Rückkehr – Das Nachleben einer Pathosformel
Elisabeth Bronfen, Zürich – Wissenschaftspreisträgerin der Aby-Warburg-Stiftung und Fünfte Trägerin der Martin Warnke-Medaille
Hamburg für alle – aber wie? (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, ESA, Hörsaal K)
Im Rahmen der Vorlesungsreihe „Hamburg für alle – aber wie?“
Koordination: Cornelia Springer.
Wohnen ist ein Menschenrecht! Bezahlbarer Wohnraum in Hamburg jedoch knapp. Die Auseinandersetzung mit Armut, Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Das Studienprogramm „Hamburg für alle – aber wie?“ möchte Studierende für die Relevanz und Komplexität dieses großen Themas und für die Lebenslagen von Betroffenen sensibilisieren.
Campus und Community zusammenbringen:
Third Mission von Hochschulen
Im Gedanken der „Third Mission“ von Hochschulen und anknüpfend an das Konzept des Lernens durch Engagement/ Service Learning soll der Wissenstransfer zwischen Universität und Gesellschaft verbessert und wissenschaftliches Studium gezielt mit zivilgesellschaftlichem Engagement verzahnt werden. Dies drückt sich in der Struktur des Programms aus:
Die interdisziplinäre Ringvorlesung (montags von 18-20 Uhr, Hörsaal ESA K) vereint Vorträge zu Themen, die für ein theoretisches Hintergrundwissen sowie für die praktische Freiwilligenarbeit relevant sind. Als Referent/innen sind Expert/innen aus der Praxis, aus Politik, Journalismus und Wissenschaft geladen, die viel Erfahrung haben und mit den Zuhörer/innen teilen. Folgende Kernthemen prägen die Reihe:
Die Ringvorlesung wird durch ein spezifisches Exkursionsprogramm zu Behörden, NGOs und Initiativen ergänzt. Im Rahmen der Projekt- und Forschungswerkstatt (Montag, 16-18 Uhr) engagieren sich die Teilnehmer/innen ehrenamtlich in Projekten für Wohnungs- und Obdachlose bzw. entwickeln eigenständig Projekte. Sie bieten den Menschen Unterstützung an und leisten so einen aktiven Beitrag zur Verbesserung deren Lebenssituation und zum sozialen Zusammenleben in der Stadt.
23.10.2017
Leben in Armut – Leben in Würde. Einblicke in das Hamburger Straßenleben (Fotovortrag)
Mauricio Bustamante, Fotojournalist und Dokumentarfotograf, Hamburg
30.10.2017
Professionelle Unterstützungsstrukturen für Wohnungs- und Obdachlose – ein Überblick
Wiebke Krause, Teamleitung Caritas Hamburg
06.11.2017
Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Hamburg: Ursachen, Statistik, Hilfe- und Unterstützungssystem
Stephan Karrenbauer, Sozialarbeiter, Hinz&Kunzt. Das Hamburger Straßenmagazin
13.11.2017
Öffentliche Unterbringung und Winternotprogramm für obdachlose Menschen
Katrin Wollberg, Bereichsleitung Spezialangebote Öffentliche Unterbringung, f&w fördern und wohnen AöR, Hamburg
20.11.2017
Bezahlbar und integrativ: Was gute Architektur für das Zusammenleben leistet
Alexander Hagner, Architekturbüro gaupenraub, Wien und Stiftungsprofessur für Soziales Bauen, Fachhochschule Kärnten
27.11.2017
Armut und Gesundheit: Medizinische Hilfe für Obdachlose
Andrea Hniopek, Leitung Abteilung Existenzsicherung, Caritas Hamburg
04.12.2017
Hamburg für alle? Armutsbekämpfung als kommunaler Auftrag
Falko Droßmann, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte
11.12.2017
Do we have a moral obligation to help the homeless? (in englischer Sprache)
Prof. Dr. Matthew Braham, Professur für Praktische Philosophie, Universität Hamburg
18.12.2017
Disconnected Youth: Lebenslagen von Straßenkindern und jungen Obdachlosen
Burkhard Czarnitzki, Abteilungsleitung, KIDS Anlaufstelle für Straßenkinder – basis & woge e.V., Hamburg
25.12.2017, 01.01. und 08.01.2018:
kein Vortrag/Aufzeichnung
15.01.2017
Arbeitsmigration – Armutsmigration? Obdachlose aus Osteuropa
Andreas Stasiewicz, Koordinator, Projekt plata · hoffnungsorte hamburg
22.01.2018
Lebenslagen obdachloser Frauen
Andrea Hniopek, Leitung Abteilung Existenzsicherung, Caritas Hamburg
29.01.2018
Unter Palmen aus Stahl: Die Geschichte eines Straßenjungen (Lesung)
Dominik Bloh, Autor
Revolution als Prozess. Das Jahr 1917 und seine Folgen (Ringvorlesung, Mi. 16–18, ESA West, Raum 221)
Im Rahmen der Vorlesungsreihe „Revolution als Prozess. Das Jahr 1917 und seine Folgen“
Koordination: Renata Rakoczy-Dahlmann.
Im Jahr 2017 jährt sich der Ausbruch der Russischen Revolution zum 100. Mal. Die Oktoberrevolution hat Russland, Europa und die Welt tiefgreifend verändert und das letzte Jahrhundert nachhaltig geprägt.
Die Ringvorlesung bietet eine breite Auseinandersetzung mit dem revolutionären Ereignis des Jahres 1917 und seinen Folgen aus der Perspektive verschiedener Fächer wie Geschichte, Slavistik, aber auch Literatur-, Kunst- und Musikwissenschaft. Die Vortragenden widmen sich in ihren Beiträgen der Revolution und den Prozessen, die sie in Gang gesetzt hat. Sie untersuchen schlaglichtartig Aspekte der Revolution jenseits der Zentren in Zentralasien, im Kaukasus, im Baltikum und im Hohen Norden. Des weiteren analysiert die Vorlesungsreihe die langanhaltenden kulturellen Auswirkungen der Revolution in Sprache, Literatur, Massenkultur und Musik.
Abschließend werden Expertinnen und Experten das Nachleben der Revolution in der aktuellen Kultur behandeln und die Bedeutung der Revolution für das heutige Russland thematisieren.
18.10.2017
Einführung: Was war im Ersten Weltkrieg revolutionär? Die Russische Revolution und andere Umwälzungen in Osteuropa
Prof. Dr. Frank Golczewski, Universität Hamburg
25.10.2017
Chaos und Ordnung. Das revolutionäre Russland auf der Suche nach dem Staat (1917-1922)
Prof. Dr. Nikolaus Katzer, Deutsches Historisches Institut Moskau
01.10.-15.11.2017
Keine Aufzeichnung
22.11.2017
Sozialer Aufstand oder nationale Emanzipation – was war die Revolution von 1917 in den Ostseeprovinzen?
Dr. David Feest, Universität Hamburg
29.11.+06.12.2017
Keine Aufzeichnung
13.12.2017
Zwischen Mobilisierung und Disziplinierung: Massenkultur im sowjetischen Propagandastaat
Prof. Dr. Malte Rolf, Universität Bamberg
20.12.2017-10.01.2018
Keine Aufzeichnung
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2017
Refugees Welcome – aber wie? (Vortragsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA, Hörsaal K)
Refugees Welcome - aber wie?
Qualifizierungsprogramm für Studierende, die sich freiwillig für Geflüchtete
Koordination: Cornelia Springer.
Mit geflüchteten Menschen zu arbeiten ist eine intensive und herausfordernde Aufgabe. Nicht selten treten in der Praxis Fragen und Unsicherheiten auf, auf die freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer spontan reagieren müssen. Um Studierende auf entsprechende Tätigkeiten vorzubereiten und in ihrem Engagement zu begleiten, vermittelt die Veranstaltung ein Grundlagenwissen, das für die praktische Arbeit mit geflüchteten Menschen relevant ist.
Das Studienprogramm erstreckt sich über zwei Semester, die sich thematisch ergänzen. Die inhaltlichen Schwerpunkte bilden u.a. folgende Themen: Fluchtursachen und Fluchtrouten, realpolitische Lage in Herkunftsländern und -regionen, Islam im Alltag, Grundinformationen Asyl- und Ausländerrecht, Organisations- und Kommunikationsstrukturen in Hamburger Behörden, Umgang mit sprachlicher und kultureller Verschiedenheit, Rollenverständnis von Freiwilligen zwischen Verantwortung und Abgrenzung, Werkzeuge für ein interaktives, alltagsorientiertes Deutsch-als-Fremdsprache-Training, sensibler Umgang mit traumatisierten Menschen.
Für weitere Informationen, besuchen Sie auch das Blog der Veranstaltung: http://refugees-welcome.blogs.uni-hamburg.de/vortragsreihe-sose17/.
25. April 2017
Asyl- und Flüchtlingsrecht für Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten
Claudius Simon Brenneisen, Rechtsanwalt, u.a. bei flucht.punkt, Hilfsstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche Nordelbien in Hamburg
2. Mai 2017
Hamburg als Willkommensstadt? Herausforderungen für Politik, Verwaltung und Gesellschaft
Uwe Giffei, SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg, Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration
09. Mai 2017
Vom Kolonialherren zum Entwicklungshelfer. Fluchtursachen zwischen Kontinuitäten und Brüchen westlicher Wirtschafts- und Außenpolitik
Jannik Veenhuis, Islamwissenschaftler, Junge Akademie für Zukunftsfragen
16. Mai 2017
Von der Unterbringung zum Wohnen. Welche Anforderungen lassen sich daraus für die Stadt ableiten?
Prof. Dipl.-Ing. Bernd Kniess, Professor and Dean of Urban Design, HafenCity University Hamburg
23. Mai 2017
Integration durch Sprache. BAMF und Ehrenamtliche Hand in Hand
Dr. Patrick Grommes, Universität Hamburg, Projekt ProfaLe Qualitätsoffensive Lehrerbildung
30. Mai und 6. Juni 2017
kein Vortrag
13. Juni 2017
We are here to stay! Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg
Sieghard Wilm, Pastor, St. Pauli Kirche Hamburg
20. Juni 2017
Dolmetschen in der Flüchtlingsarbeit – Rolle, Grenzen, Kompetenzen von Ehrenamtlichen
Reinhard Pohl, Freier Journalist und Herausgeber der Zeitschrift 'Gegenwind'
27. Juni 2017
Islam und Europa: Zu Fragen, Facetten und Faktoren gegenseitiger Wahrnehmung
Jannik Veenhuis, Islamwissenschaftler, Junge Akademie für Zukunftsfragen
04. Juli 2017
Fotovortrag: Seenotrettung im Mittelmeer. Aktivist*innen von Jugend Rettet e.V. berichten von Rettungsmissionen mit ihrem Schiff Iuventa
Aktivist*innen, die 2016 und 2017 an Rettungsmissionen teilgenommen haben, berichten in einem beeindruckenden Fotovortrag von ihren Erfahrungen: Nicolas Liebich, 19 Jahre, 2. Offizier | Alexander Wenzel, 55 Jahre, Bootfahrer | Mona Reichart, 31 Jahre, Bootfahrerin
11. Juli 2017
kein Vortrag
(Fast) 100 Jahre Universität Hamburg Teil 1 (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, ESA, Hörsaal J)
(Fast) 100 Jahre Universität Hamburg
Teil 1 der Ringvorlesung
Koordination: Prof. Dr. Rainer Nicolaysen
Das Jubiläum „1919-2019 – 100 Jahre Universität Hamburg“ steht vor der Tür – und bietet einen besonderen Anlass zur Beschäftigung mit Geschichte, Gegenwart und Perspektiven unserer Universität. Im Rahmen der umfangreichen Aktivitäten im Jubiläumsjahr wird auch eine mehrbändige Universitätsgeschichte erscheinen, die als multiperspektivische Darstellung sowohl übergreifende Themen und Fragestellungen zur Geschichte der Hamburger Universität behandeln als auch möglichst flächendeckend und quer durch alle Fakultäten die Geschichte einzelner Fächer präsentieren wird. Etwa 80 Autorinnen und Autoren sind an diesem gesamtuniversitären Projekt beteiligt.
Alle Aufzeichnungen der Veranstaltung finden Sie auf Lecture2Go unter: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4840
Die auf mehrere Semester angelegte Ringvorlesung bietet den zur Hamburger Universitätsgeschichte arbeitenden Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit, ihre laufende Forschung einem breiten Publikum vorzustellen und (Zwischen-) Ergebnisse zu diskutieren.
Die Vorlesungsreihe wird von der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte in Kooperation mit dem Forschungsverbund Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH) und dem Verein für Hamburgische Geschichte (VHG) veranstaltet. Sie ist zugleich Teil XIV der vom FKGHH seit 2007 organisierten Vorlesungsreihe „Andocken“.
Die Vorlesungsreihe wird koordiniert von Prof. Dr. Rainer Nicolaysen, gefördert vom Förderverein des Kontaktstudiums.
03.04.2017
Die erste demokratische Universitätsgründung in Deutschland. Über die Geschichte der Hamburger Universität und Wege ihrer Erforschung – ein einleitender Überblick
Prof. Dr. Rainer Nicolaysen, Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte, Universität Hamburg
10.04.2017
Geist und/gegen Geld. Werner von Melle als Universitätsdesigner
Myriam Isabell Richter, M. A., Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung
24.04.2017
Ein neues Recherchewerkzeug zur Hamburger Universitätsgeschichte. Möglichkeiten und Grenzen des Hamburger Professorinnen- und Professorenkatalogs
Matthias Glasow, M. A., ehem. Leiter des Hamburger Professorinnen- und Professorenkatalogs,
Universität Hamburg
08.05.2017
Entnazifiziert. Der historische „Ort“ der politischen Vergangenheitsüberprüfung in der Geschichte der Universität Hamburg
Anton F. Guhl, M.A., Institut für Geschichte, Karlsruher Institut für Technologie
15.05.2017
Gesammeltes Wissen – Wissenschaftliche Sammlungen. Geschichte und Gegenwart objekt-
basierter Forschungs- und Lehrinfrastrukturen an der Universität Hamburg
Dr. Antje Zare, Zentralstelle für wissenschaftliche Sammlungen, Universität Hamburg
22.05.2017
Leuchtturm oder Lückenfüller – Die Rolle der Universität in der Hamburger Stadtplanung
Michael Holtmann, Stadtplaner, ehem. Leiter der Bauabteilung, Universität Hamburg
29.05.2017
Vom Gelehrtenbildnis zur Computergraphik – Kunstschätze der Universität Hamburg. Ein Werkstattbericht
Prof. Dr. Iris Wenderholm / Dr. Christina Kuhli, beide Kunstgeschichtliches Seminar, Universität Hamburg
12.06.2017
Wechselfälle eines Faches und seiner Institutionalisierung: 100 Jahre Romanistik in Hamburg
Prof. em. Dr. Klaus Meyer-Minnemann, Institut für Romanistik, Universität Hamburg
19.06.2017
Kinderkardiologie am UKE 1960-2010 – Von den Anfängen als pädiatrische Spezialdisziplin zur multidisziplinären High-Tech-Medizin. Zu Fragen der Fachgeschichte unter Einbeziehung der Oral History
Dr. Johanna Meyer-Lenz, Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH), Universität Hamburg
26.06.2017
Die Wut der Bella Block, wenn Pfefferkörner in Wolke 7 über dem Campus schweben und sie der Tiger küsst. Zur Darstellung der Universität Hamburg in Spielfilmen und Serien
Prof. Dr. Joan Kristin Bleicher, Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg
03.07.2017
Vom „Seminar für Englische Sprache und Kultur“ zum „Institut für Anglistik und Amerikanistik“
Prof. em. Dr. Peter Hühn, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Hamburg
10.07.2017
Von der Vorlesung zum Projektseminar – 100 Jahre Lehre und Studium an der Universität Hamburg
Prof. Dr. Holger Fischer, ehem. Vizepräsident für Studium und Lehre, Universität Hamburg
Warburg-Haus 2017: Latenz in den Künsten (Vorlesungsreihe, Di. 19 Uhr)
Aby Warburg
Interdisziplinäres Forum für Kunst- und Kulturwissenschaften
Koordination: Dr. Katharina Hoins
Das Hamburger Warburg-Haus versteht sich als Impulsgeber in einer lebendigen Hamburger Wissenschaftslandschaft. Als Einrichtung der Universität Hamburg und der Aby-Warburg-Stiftung sowie gefördert von der Hamburger Behörde für Wissenschaft und Forschung widmet es sich geistes- und kulturgeschichtlicher Spitzenforschung und wirkt gleichzeitig durch die gesellschaftspolitische Relevanz seiner Themen und Methoden in die Öffentlichkeit hinein.
Es sieht sich seiner Geschichte und der Tradition von Forscherpersönlichkeiten wie Aby Warburg, Erwin Panofsky und Ernst Cassirer verpflichtet und erhebt den Anspruch, den wissenschaftlichen Aufbruch dieser Gründergeneration der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg für die Forschungsherausforderungen der Gegenwart zu aktualisieren. Leitgedanke ist die Weiterentwicklung und kritische Reflexion der interdisziplinären Kunst- und Kulturforschung, wie sie von Warburg und seinem Kreis programmatisch entwickelt wurde.
In unregelmäßigen Abständen zeichnet das eLearning-Büro der Fakultät für Geisteswissenschaften einzelne Vorträge im Warburg-Haus auf. Für kommende Termine besuchen Sie bitte die Homepage des Warburg-Hauses unter: http://www.warburg-haus.de/.
05.04.2017
Der Gerichtspfeiler als Gedankenpfeiler: Bewegung, Bildmedium und Gedächtnis im Südquerhaus des Straβburger Münsters
Jacqueline E. Jung, Yale University
25.04.2017
Flüchtige Form. Passantinnen bei Baudelaire, Freud und Warburg
Dr. Cornelia Wild, Ludwig-Maximilians-Universität München
17.05.2017
Der malende Teufel. Zum ästhetischen Potential des ‚mille artifex‘
Prof. Dr. Jörg Jochen Berns, Universität Marburg
22.05.2017
Latente Beziehungen: Figur, Plastizität und ›Nachleben‹ bei Warburg und Auerbach
Niklaus Largier, Berkeley University
Florentiner Musik des Mittelalters wiederentdeckt (Buchvorstellung von Dr. Andreas Janke & John Nádas Lucca, Do. 17 Uhr, SFB 950, Warburgstraße 26, 20354 Hamburg)
Florentiner Musik des Mittelalters wiederentdeckt
01.06.2017
Buchvorstellung: Florentiner Musik des Mittelalters wiederentdeckt
Dr. Andreas Janke (Universität Hamburg) und Prof. Dr. John Nádas (University of North Carolina)
Anfang des 15. Jahrhunderts wurde von einem Schreiber in Florenz ein Musikmanuskript mit mehr als 200 weltlichen italienischen und französischen Liedern fertiggestellt. Nachdem diese gegen Ende desselben Jahrhunderts aus der Mode gekommen waren, wurde die Musik vom Pergament abgeschabt, um dieses als Schreibgrundlage für ein neues Manuskript zu recyceln – diesmal ein Buch zur Aufzeichnung der Besitztümer der Kirche San Lorenzo in Florenz. Anfang der 1980er Jahre wurden schließlich Spuren der ursprünglichen Musik wiederentdeckt.
Erst durch die Zusammenarbeit von Geistes- und Naturwissenschaftlern ist es gelungen die ursprüngliche Notation wieder sichtbar zu machen und so die Musiksammlung zu rekonstruieren. Die Ergebnisse mehrjähriger Arbeit, inklusive Abbildungen der rekonstruierten 111 Blätter des originalen Musikmanuskripts, wurden mittlerweile veröffentlicht.
Der SFB 950 lädt ein zur Buchvorstellung:
The San Lorenzo Palimpsest. Florence Archivio del Capitolo di San Lorenzo Ms. 2211. Introductory Study and Multispectral Images, 2 Bde., hrsg. von Andreas Janke und John Nádas Lucca 2016
Das sogenannte San-Lorenzo-Palimpsest erlaubt einen Einblick in das Florentiner Musikleben am Anfang des 15. Jahrhunderts und enthält Kompositionen der angesehensten Komponisten dieser Zeit. Unter ihnen finden sich professionelle Organisten, die an den wichtigsten Florentiner Institutionen angestellt waren, so z. B. an der Kathedrale Santa Maria del Fiore. Die Musiksammlung enthält neben bereits bekannten Kompositionen nicht nur aufschlussreiche Varianten, sondern zudem bisher unbekannte und nur in diesem Manuskript überlieferte Kompositionen.
Die Buchvorstellung gibt einen Einblick in die aufwändige Erschließung dieses einmaligen Manuskripts, von der Entdeckung der unlesbaren Musik, über den Einsatz modernster Technik zur Rekonstruktion (Multispektralkamera) und schließlich der Übertragung der mittelalterlichen Notation. Begleitet wird die Veranstaltung durch das Baseler Ensemble LA MORRA, das die Musik aus dem Manuskript nach über 500 Jahren wieder zum Erklingen bringt.
Osteuropaforschung in Deutschland (Ringvorlesung, Di. 18–20 Uhr, Hörsaal der StaBi)
Osteuropaforschung in Deutschland: Aktuelle Positionsbestimmungen
Vortragsreihe mit drei Gastvorträgen
Koordination: Renata Rakoczy-Dahlmann
Osteuropastudien Universität Hamburg und Institut für Slavistik in enger Zusammenarbeit mit DGO e.V., Zweigstelle Hamburg laden herzlich ein, zu einer Vortragsreihe zum Thema: „Osteuropaforschung in Deutschland. Aktuelle Positionsbestimmungen.“
Nach der von Enthusiasmus und Aufbruchsstimmung geprägten Wahrnehmung unserer östlichen Nachbarn in den 1990er und frühen 2000er Jahre hat sich der Blick auf Mittelosteuropa und Russland in den letzten Jahren wieder gewandelt. Ukrainekrise, Spannungen zwischen Russland und seinen Nachbarn, zunehmender Nationalismus, Demokratieabbau insbesondere in Ungarn und Polen, Flüchtlingskrise und fragile wirtschaftliche Lage – Mittelosteuropa steht vor großen Herausforderungen. Aus dieser Lage ergibt sich für die deutsche Forschung zu Osteuropa eine ganze Reihe von Fragen: Wie gehen wir damit um, dass die deutsche Wahrnehmung der Region zunehmend von Krisenphänomene geprägt ist? Bedarf die Osteuropaforschung einer neuen Ausrichtung und Architektur um diesen Problemen gerecht zu werden? Wo liegen neue Schwerpunkte der Osteuropaforschung und mit welchen inhaltlichen und methodischen Problemen muss sie sich auseinandersetzen? In welcher Form können sich die an der Osteuropaforschung beteiligten Disziplinen, in die aktuelle Debatte um Osteuropa einschalten?
In der Vortragsreihe wird von führenden VertreterInnen der Osteuropaforschung aus drei Forschungseinrichtungen in Deutschland diesen Fragen nachgegangen. Es wird gefragt, inwiefern sich die deutsche Forschungslandschaft durch die politischen Umbrüche von 1989/91 verändert hat und wo die Schwerpunkte der neuen Forschungsaufgaben und -diskussionen liegen.
27.06.2017
Das ZOiS in Berlin: Neue Akzente in der Osteuropaforschung
Prof. Dr. Gwendolyn Sasse, ZOIS Berlin
20.06.2017
Osteuropa in Bremen? Konjunkturen und Krisen einer besonderen Beziehung
Prof. Dr. Susanne Schattenberg, Universität Bremen
13.06.2017
Peripherie, Nationalismus und Globalisierung. Südosteuropa neu denken
Prof. Dr. Ulf Brunnbauer, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropafoschung, Regensburg
Who owns the South China Sea? (Einzelvortrag von Bill Hayton, 19.05.2017, Asien-Afrika-Institut)
Who owns the South China Sea?
Einzelvortrag am Asien-Afrika-Institut
19.05.2017
Who owns the South China Sea?
Bill Hayton, BBC News
Koordination: Cao Quang Nghiep
The South China Sea is where China’s rising ambitions are colliding with the United States’ global role. This strategic competition is interacting in dangerous and unpredictable ways with tensions about the fate of the atolls and island that dot the sea: the Spratly Islands, the Paracels and Scarborough Shoal. Bill Hayton will explain the - sometimes bizarre - origins of the various claims and suggest how they might be resolved.
Bill Hayton was appointed an associate fellow of Chatham House in 2015. He is the author of ‘The South China Sea: the struggle for power in Asia’ that was published by Yale Univer- sity Press and named as one of The Economist's books of the year in 2014. His previous book, ‘Vietnam: rising dragon’, was published in 2010, also by Yale.
Bill Hayton has worked for the BBC since 1998 and currently works for BBC World News television in London. In 2006-07 he was the BBC's reporter in Vietnam and spent a year in 2013 embedded with Myanmar's state broadcaster working on media reform. He has given presentations about South China Sea and Southeast Asian issues for think-tanks and government institutions in the UK, US, the Philippines, Malaysia, Indonesia and Singapore. His written work has been published in The Economist, the South China Morning Post, The Diplomat and the National Interest, among others.He graduated from the University of Cambridge in 1990.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2016/17
Zum 150. Geburtstag von Aby Warburg (Vorlesungsreihe, Mo. 13.06.2018)
Zum 150. Geburtstag von Aby Warburg
Koordination: Katharina Hoins.
„Jude von Geburt, Hamburger im Herzen, im Geiste Florentiner“, formulierte Aby Warburg (13.6.1866-26.10.1929) über sich selbst. Als einer der Wegbereiter der modernen Kulturwissenschaften widmete er sein Lebenswerk dem Einfluss der Antike auf die Neuzeit. Von Räumen zum Denken, Bildern in Formeln und dem Prinzip der Guten Nachbarschaft der Bücher.
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine semesterübergreifende Vorlesungsreihe. Die Termine können Sie folgendem Link entnehmen: www.warburg-haus.de
18.10.2016
Manet, Manebit! Aby Warburgs "Manet und die italienische Antike" als psycho-intellektuelles Selbsporträt
Prof. Dr. Uwe Fleckner, Universität Hamburg
Achtsamkeit – Kritischer Blick auf einen Trend (Ringvorlesung, Do. 18–20 Uhr, ESA Ost, Raum 221)
Achtsamkeit – Kritischer Blick auf einen Trend
Koordination: Prof. Dr. Steffen Döll/Prof. Dr. Michael Zimmermann, beide Fachbereich Asien-Afrika-Wissenschaften, Numata Zentrum für Buddhismuskunde, Universität Hamburg / in Kooperation mit dem netzwerk ethik heute
Achtsamkeit ist längst zu einem Trend geworden. Der bekannte Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx meint, darin vor allem einen Gegentrend zu Beschleunigung und Effizienz zu erkennen, aber auch zu Wellness und Entspannung. Besonders durch die Verbreitung des Programms „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ (MBSR) hat Achtsamkeit an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben die Wirksamkeit untersucht; Mediziner, Therapeuten, Pädagogen und mittlerweile auch Wirtschaftsunternehmen interessieren sich dafür. Damit ist eine kritische Reflexion überfällig.
Die Vortragsreihe beleuchtet den Achtsamkeitshype aus verschiedenen Perspektiven: Buddhisten kritisieren, dass die heute geläufigen Achtsamkeitsübungen auf halbem Wege stecken blieben und die Verbindung sowohl zur Ethik als auch zur Weisheit gekappt hätten. Welche Bedeutungen hat die Achtsamkeit im buddhistischen Kontext? Aus gesellschaftspolitischer Perspektive ist der Vorwurf formuliert worden, Achtsamkeit sei nur auf das Subjekt bezogen und blende gesellschaftliche Kontexte unzulässig aus. Ist Achtsamkeit also bloßer Eskapismus, der Rückzug ins Private? Und wie ist es ethisch zu bewerten, wenn Firmen Achtsamkeit strategisch einsetzen und in den Dienst von Effizienz und Leistung stellen?
Ein weiteres Thema ist, welche Qualität die vielen Studien haben, mit denen Wirksamkeit von Achtsamkeit belegt werden soll. Wie aussagekräftig sind ihre Ergebnisse? Ist Achtsamkeit tatsächlich ein Allheilmittel für die Krankheiten unserer Zeit? Referenten aus verschiedenen Disziplinen setzen sich mit diesen Fragen auseinander und diskutieren mit dem Publikum.
Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Die Veranstaltung findet als Kooperation zwischen dem Numata Zentrum für Buddhismuskunde und dem Netzwerk ethik heute statt.
27.10.2016
Achtsamkeit und Selbstbezogenheit – eine Kritik aus gesellschaftspolitischer Sicht
Prof. Dr. Hartmut Rosa, Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Direktor des Max-Weber-Kollegs, Erfurt
17.11.2016
Ist Achtsamkeit für jeden gut? Neue Forschungsergebnisse
Dr. Ulrich Ott, Bender Institute of Neuroimaging, Justus-Liebig-Universität Gießen
15.12.2016
Achtsamkeit – eine elementare Kulturtechnik? Für einen Bildungsdiskurs über die Achtsamkeit
Dr. Irina Spiegel, Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, Ludwig-Maximilians-Universität München
26.01.2017
Achtsamkeit im Buddhismus: Ursprünge der MBSR-Praxis
Dr. Jowita Kramer, Ludwig-Maximilians-Universität München
Andocken XIII: Migration in Hamburg (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, Philosophenturm, Hörsaal F)
Andocken XIII: Migration in Hamburg
Flucht und Exil von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
Koordination: Prof. i. R. Dr. Franklin Kopitzsch, Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte / Dr. Johanna Meyer-Lenz / Dr. Ralf Erik Werner, alle Universität Hamburg / Dr. Nele Maya Fahnenbruck, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Landesverband Hamburg
Die Fortsetzung der Vorlesungsreihe vom Sommersemester 2016 widmet sich den Aspekten von Migration und Exil im „langen 19. Jahrhundert“ (Hobsbawm), im „kurzen 20. Jahrhundert“ (Berend) und in der Zeitgeschichte. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die vielfältigen Erfahrungen des Exils mit dem Fluchtpunkt Hamburg. Exil steht hier zum einen stellvertretend für ein abruptes Verlassen des bisherigen Lebensortes und den erzwungenen Übertritt in eine fremde unbekannte Welt. Exil kann zum anderen auch den Übergang an einen anderen topografischen Ort und einen neuen Lebensentwurf über eine längere zeitliche Perspektive bedeuten.
Der Eintritt in eine lebensbedrohliche und die bisherige Lebensweise zerstörende Existenz konfrontiert die Betroffenen mit schwerwiegenden schicksalhaften Situationen mit geringen Handlungsoptionen (z. B.: Boatpeople, jüdische Ärzte in der Emigration).
Form und Grad der Mischung neuer und alter habitualisierter Lebensweisen wird als zentrales Thema um die vielfältigen Ausformungen von Integration ausgestaltet und in unterschiedlichen historischen, kulturellen und transnationalen Kontexten vorgestellt. Sie verbinden Hamburg mit Schauplätzen in Europa, den USA, Australien und Asien und umfassen das 17. bis 21. Jahrhundert. Neue Forschungsansätze erschließen beispielsweise die Geschichte des Wohnens als zentrale Kategorie für die Betrachtung der Migration, ebenso der Literatur- und Filmästhetik. Eine zusammenfassende Betrachtung der Vorlesungsreihe zur Migration in Hamburg als kulturhistorisches Forschungsfeld dient im Laufe des Semesters der Orientierung und dem reflektierenden Austausch mit dem Auditorium. Dabei sollen Anregungen aus aktuellen Debatten zum Thema „Flucht“ auch im außeruniversitären, zivilgesellschaftlichen Kontext und im Bereich der städtischen Akteure aufgenommen werden.
Die Vorlesungsreihe wird gemeinsam vom Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH), Universität Hamburg, und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Landesverband Hamburg veranstaltet. Sie wird gefördert durch die Stiftung Gedenken und Frieden.
17.10.2016
Schicksale von dauerhaft und kurzfristig in die Amerikas ausgewanderten Hamburgern zwischen den 1780–1840
Prof. Dr. Claudia Schnurmann, Universität Hamburg
24.10.2016
Keine Aufzeichnung
31.10.2016
Das Ende einer Odyssee: vietnamesische Bootsflüchtlinge in Hamburg
Dr. Frank Weigelt, Universität Hamburg
07.11.2016
Keine Aufzeichnung
14.11.2016
„Hamburg ist schihr ein irdisches Paradis“ - Gelehrtenmigration im 17. und 18. Jahrhundert
Claudia Sodemann-Fast, M.A., Universität Hamburg
21.11.2016
Reflektionen über den Nachhall der Kriegs- und Nachkriegsmigration Polen-Deutschland-Brasilien in der eigenen Familie
Julie Lindahl, M.A., schwedische Autorin
28.11.2016
"Ze Hamburg do luby swêt - "Von Hamburg aus in die Welt" Sorbische Emigranten auf dem Weg nach Australien und Texas im ,langen 19. Jahrhundert'
Sven Brajer, M.A., Technische Universität Dresden
12.12.2016
Wohnen als flüchtige Praxis? Flüchlingsunterbringung in Hamburg: Wechselbeziehung zwischen Wohnpraktiken und der Stadt
Maja Momic, HafenCity Universität Hamburg
19.12.2016
Wilhelm Ernst Beckmann (1909-1965). Holzbildhauer, Hamburger und Sozialdemokrat findet Asyl in Island
Dr. Lilja Schopka-Brasch
16.01.2017
Ein anderes Sprechen von Exil. Hamburg als Referenz für Exil als Lebensperspektive
Dr. Astrid Henning-Mohr, Universität Oldenburg
23.01.2017
Ein anderes Exil: Alice Ekert-Rotholz und der „Ferne Osten“
Dr. Björn Laser, Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd
30.01.2017
"Überdies hat mein sog. Vaterland grundlos grausam an mir gehandelt." Jüdische Ärtze auf der Flucht ins Exil,in den Untergrund oder in den Tod
Dr. Rebecca Schwoch, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Lesungen mit osteuropäischen Autoren im Rahmen des Projektes „Go East - Go West!“
Das Projekt „Go East – Go West! Transnationale und translinguale Identitäten zwischen Deutschland und Mittelosteuropa” am Institut für Slavistik der Universität Hamburg untersucht die vielfältigen Bewegungen und Begegnungen zwischen Ost und West in der Literatur.
Weiteres zum Projekt finden Sie hier.
Im Rahmen dieses Projektes wurden mehrere Lesungen mit osteuropäischen Autoren veranstaltet. Hier finden Sie die Vorlesung mit Saša Stanišić; die weiteren Videos finden Sie hier.

Lektionen der Geschichte (Ringvorlesung, Mi. 18–20 Uhr, Philosophenturm, Hörsaal D)
Lektionen der Geschichte
Was, wenn überhaupt etwas, kann die Philosophie aus ihrer Geschichte lernen?
Koordination: Prof. Dr. Stephan Schmid, Fachbereich Philosophie, Arbeitsbereich Geschichte der Philosophie, Universität Hamburg.
Die Philosophie hat ein eigentümliches Verhältnis zu ihrer Geschichte. Anders als in anderen Wissenschaften spielt die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte in philosophischer Forschung und Lehre eine zentrale Rolle. Doch warum und mit welchem Recht ist das so? Ist die zentrale Rolle der Philosophiegeschichte in der Philosophie sachlich zu rechtfertigen? Und wenn ja, wie? Was, wenn überhaupt etwas, kann die Philosophie aus ihrer Geschichte lernen?
Die zweiwöchentlich stattfindende Ringvorlesung stellt exemplarisch philosophische Lektionen ihrer Geschichte vor und/oder diskutiert das Verhältnis zwischen der Philosophie und ihrer Geschichte.
19.10.2016
Keine Aufzeichnung
02.11.2016
Und der Fortschritt, er ist doch kein leerer Wahn: Unbefriedigtsein bei Epikur, John Locke und Ludwig von Mises
Prof. Dr. Rolf W. Puster, Fachbereich Philosophie, Arbeitsbereich Geschichte der Philosophie, Universität Hamburg
16.11.2016
Philosophiegeschichte als Problemarchäologie: Methodologische Überlegungen
Prof. Dr. Dr. h.c. Dominik Perler, Institut für Philosophie, Arbeitsbereich Theoretische Philosophie, Humboldt-Universität zu Berlin
30.11./14.12.2016 und 11.01.2017
Keine Aufzeichnung
25.01.2017
Thinking Through our Philosophical Heritage
Prof. Dr. Michael Beaney, Institut für Philosophie, Humboldt-Universität zu Berlin / King’s College London, UK
Refugees Welcome – aber wie? (Vortragsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA, Hörsaal K)
Refugees welcome – aber wie?
Qualifizierungsprogramm für Studierende, die sich freiwillig für Geflüchtete engagieren
Koordination: Cornelia Springer.
Mit geflüchteten Menschen zu arbeiten ist eine intensive und herausfordernde Aufgabe. Nicht selten treten in der Praxis Fragen und Unsicherheiten auf, auf die freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer spontan reagieren müssen. Um Studierende auf entsprechende Tätigkeiten vorzubereiten und in ihrem Engagement zu begleiten, vermittelt die Veranstaltung ein Grundlagenwissen, das für die praktische Arbeit mit geflüchteten Menschen relevant ist.
Das Studienprogramm erstreckt sich über zwei Semester, die sich thematisch ergänzen. Die inhaltlichen Schwerpunkte bilden u.a. folgende Themen: Fluchtursachen und Fluchtrouten, realpolitische Lage in Herkunftsländern und -regionen, Islam im Alltag, Grundinformationen Asyl- und Ausländerrecht, Organisations- und Kommunikationsstrukturen in Hamburger Behörden, Umgang mit sprachlicher und kultureller Verschiedenheit, Rollenverständnis von Freiwilligen zwischen Verantwortung und Abgrenzung, Werkzeuge für ein interaktives, alltagsorientiertes Deutsch-als-Fremdsprache-Training, sensibler Umgang mit traumatisierten Menschen.
18.10.2016
Keine Aufzeichnung
25.10.2016
Refugee Rights – Aspirations and Reality in USA, Germany/Europe and South Africa
J.D. Madaline George, Citizen of the World
01.11.2016
Keine Aufzeichnung
08.11.2016
Bilder von Geflüchteten im öffentlichen Raum
Paul Steffen, Junge Akademie für Zukunftsfragen
15.11.2016
Keine Aufzeichnung
22.11.2016
Freiwilliges Engagement in der Flüchtlingsarbeit als Berufsvorbereitung und Qualifizierung für Akademiker/innen?
Pia-Mareike Heine, Caritasverband für Hamburg e.V.
29.11.2016
Keine Aufzeichnung
06.12.2016
Zwischen Exklusion und Turbointegration. Alternative Lösungsansätze für eine lebenslagenorientierte Teilhabe von Geflüchteten am Arbeitsmarkt
Franziska Voges, Passage Hamburg
13.12.2016
Grundinformationen Asyl- und Ausländerrecht für Flüchtlingsunterstützer/innen
Claudius Brenneisen, flucht.punkt
17.01.2017
Der eritreische Nationaldienst und seine Auswirkungen auf die Gesellschaftsstruktur
Dr. Nicole Hirt, assoziiert mit GIGA-Institut für Afrika-Studien
24.01.2017
Herkunftsregionen und Fluchtursachen: Syrien und Irak. Konfliktgeschichte und aktuelle Lage
Dr. André Bank, GIGA-Institut für Nahost-Studien
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2016
Andocken XII: Migration in Hamburg (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, ESA, Hörsaal M)
Andocken XII: Migration in Hamburg
Flucht und Exil von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
Koordination: Prof. em. Dr. Franklin Kopitzsch, Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte / Dr. Johanna Meyer-Lenz / Dr. Ralf Werner, beide Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH), Institut für Germanistik, alle Universität Hamburg / Dr. Nele Fahnenbruck, Bildungsreferentin, komm. Geschäftsführerin, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Flüchtlinge möchte die Vorlesungsreihe einen Beitrag zu einer historisch vertiefenden Betrachtung der vielfältigen Flucht- und Migrationsbewegungen in ihren unterschiedlichen Perspektiven und Dimensionen zur Stadt- und Kulturgeschichte Hamburgs beitragen.
Das Themenspektrum ist sehr breit angelegt: religiös und politisch motivierte Migrationen des 17. und 18. Jahrhunderts, die Auswandererbewegung Richtung Amerika ab Mitte des 19. Jahrhunderts, Deportationen aus und nach Hamburg im Nationalsozialismus, die Integration von Flüchtlingen in der Nachkriegszeit, Immigration aus der Türkei oder die aktuelle Flüchtlingsthematik mit Geflüchteten aus Krisengebieten wie Syrien, der Balkanregion, Afrika oder Afghanistan.
Die Referierenden entfalten aus der Sicht ihrer jeweiligen Disziplinen den besonderen Bezug des Themas zu Hamburg. Ein zentraler Aspekt gilt dabei auch der Frage, inwieweit kulturelle Praktiken, die sowohl in den Alltag wie auch in die politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen – und im engeren Sinne kulturellen – Dimensionen hineinwirken, in der Themenachse ‚Flucht’ wirksam werden. Dies umfasst von der individuellen Dimension bis zur städtisch-urbanen Gesellschaft und ihrer medialen Öffentlichkeit zahlreiche gesellschaftliche Gruppen.
Die Vorlesungsreihe wird gemeinsam vom Forschungsverbund zur Kulturgeschichte Hamburgs (FKGHH) und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Landesverband Hamburg veranstaltet. Sie wird gefördert durch die Stiftung Gedenken und Frieden und dem Förderverein Kontaktstudium.
04.04.2016
Die Berichterstattung des Hamburger Abendblatts über die Flüchtlingskrise
Oliver Schirg, Hamburger Abendblatt
11.04.2016
Migration und Medien: Der Nordwestdeutsche und der Norddeutsche Rundfunk (NWDR / NDR) als integrationspolitischer Akteur in der Flüchtlingskrise nach 1945
Alina Laura Tiews, Universität Hamburg
18.04.2016
Erzählen einer Gegenöffentlichkeit. Hamburger Filmproduktionen und ihre Migrationsdiskurse
Dr. Astrid Henning-Mohr, Universität Oldenburg
25.04.2016
Die Entlausung. Mary Antin unterwegs ins gelobte Land
Prof. Dr. Monica Rüthers, Universität Hamburg
02.05.2016
Exilforschung in Hamburg: Impulse von Exilanten nach 1933 und aktuelle Perspektiven
Prof. Dr. Doerte Bischoff
09.05.2016
„Flüchtlingskinder“ und „Ausländerkinder“ in Hamburger Schulen seit 1945
Dr. Stephanie Zloch, Georg-Eckert-Institut Braunschweig
16.05.2016
Pfingstferien
23.+30.05./06.06.2016
Keine Aufzeichnung
13.06.2016
Unrühmlicher Erinnerungsort. Flucht und Deportation von Hamburger Juden, Sinti und Roma 1933-1945
Dr. Kristina Vagt, Universität Hamburg
20.06.2016
Keine Aufzeichnung
27.06.2016
Portugieseische Juden und Hamburger. Zwei Ausprägungen migrantischen Unternehmertums in der Frühen Neuzeit
Dr. Jorun Poettering, Ludwig-Maximilians-Universität München
04.07.2016
Keine Aufzeichnung
11.07.2016
„Das Exil hat, wie alle Lagen des menschlichen Lebens, sein Gutes“: Französische Revolutionsemigranten in Hamburg in den 1790er-Jahren
Dr. Friedemann Pestel, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/Universität Wien)
Flucht-Geschichte(n) (Ringvorlesung, Di. 18–20 Uhr: ESA, Hörsaal M)
Flucht-Geschichte(n)
Kulturhistorische Perspektiven auf ein aktuelles Phänomen
Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner, Universität Hamburg
Allein in diesem Jahr werden ca. eine Million Flüchtlinge in Deutschland erwartet, während sich weltweit ungefähr 60 Millionen Menschen auf der Flucht befinden. Die Ursachen für die Entscheidung von Frauen und Männern, ihre Heimstätten aufzugeben und gemeinsam in anderen Ländern Zuflucht zu suchen, sind vielfältig, in der Mehrzahl der Fälle sind es jedoch Vertreibung, Gewalt und (Bürger-)Kriege.
Ziel der Ringvorlesung ist es, ausgehend von diesem aktuellen Phänomen Flucht-Geschichte(n) in einer kulturhistorischen Perspektivierung zu beleuchten, um für die historischen und anthropologischen Dimensionen von Vertreibung und Exil zu sensibilisieren. Ausgrenzung und Verfolgung von Andersgläubigen oder Angehörigen unbekannter Ethnien/Volksgruppen gehören seit jeher und in allen Kulturen zu den zentralen Motiven weltweiter Flüchtlingsbewegungen. Bereits das Alte Testament liest sich wie eine Folge von Flucht-Geschichte(n), die sich im Mittelalter und der Frühen Neuzeit ebenso fortsetzt wie in der Moderne und Postmoderne. Weitaus präsenter in der kollektiven Erinnerung Europas sind jedoch die Migrationsbewegungen im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen und den (De-)Kolonialisisierungsprozessen, die bis heute in zahlreichen gewaltvollen Konflikten insbesondere in afrikanischen Ländern nachwirken.
Die Auseinandersetzung mit diesen Themen bedeutet, Konzepte wie Identität und Alterität zu befragen – Begriffe, die in allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen eine wichtige Rolle spielen, aber unterschiedliche Schwerpunkte und Akzentuierungen erfahren. Gerade diese Vielfalt von Perspektiven und Fachkulturen ist besonders dazu geeignet, Flucht-Geschichte(n) als Teil unseres Selbstverständnisses erlebbar zu machen.
05.04.2016
Flucht als gewaltvolle Praxis: Fluchtursachen, Fluchtwege, Fluchtpunkte
Dr. Christiane J. Fröhlich, Institut für Sicherheits- und Friedensforschung, Universität Hamburg
12.04.2016
Vertreibung, Flucht und Heimatverlust im Spiegel von Exilkompositionen
Prof. Dr. Friedrich Geiger, Institut für Historische Musikwissenschaft, Universität Hamburg
19.+26.04.2016
Keine Aufzeichnung
03.05.2016
Nation ohne Staat. Die polnische „Große Emigration“ und ihre Narrative
Dr. Anna Artwinska, Institut für Slavistik, Universität Hamburg
10.05.2016
Verletzung(en): Flucht-Räume in den romanischen Literaturen des 20./21. Jahrhunderts
Prof. Dr. Silke Segler-Meßner, Institut für Romanistik, Universität Hamburg
17.05.2016 Pfingstferien
24.05.2016
keine Aufzeichnung
31.05.2016
Ohne Worte. Migration als universelle Fremdheitserfahrung in Shaun Tans "The Arrival"
Prof. Dr. Astrid Böger, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Hamburg
07.06.2016
Keine Aufzeichnung
14.06.2016
Kaufleute, Sklaven, Flüchtlinge. Mobilität und Migration im spätmittelalterlichen Mittelmeerraum
Prof. Dr. Christoph Dartmann, Arbeitsbereich Mittelalter, Universität Hamburg
21.06.2016
Geschichte und Geschichten der retornados aus Angola
Prof. Dr. Martin Neumann, Institut für Romanistik, Universität Hamburg
28.06.2016
Der Wert öffentlicher Aufmerksamkeit. Vertreibung und Flucht von Roma
Dr. Yvonne Robel, Foschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg
05.+12.07.2016
Keine Aufzeichnung
Hamburg: Deutschlands Tor zur kolonialen Welt (Ringvorlesung, Mi. 18–21 Uhr, Philosophenturm, Hörsaal C)
Hamburg: Deutsches Tor zur kolonialen Welt
Über den Umgang mit einem schwierigen Erbe
Koordination: Prof. Dr. Jürgen Zimmerer / Kim Sebastian Todzi, M. A., beide Fachbereich Geschichte, Arbeitsbereich Globalgeschichte, Universität Hamburg.
Hamburg ist wie keine zweite deutsche Stadt mit der Geschichte des Kolonialismus verbunden. Deutschlands „Tor zur Welt“ war ein Tor zur kolonialen Welt. Zu Recht ist die Hansestadt als die „Kolonialmetropole des Kaiserreichs“ neben Berlin bezeichnet worden. Während in Berlin die politischen Entscheidungsträger des zwischen 1884 und 1918 existierenden deutschen Kolonialreiches ansässig waren, stand die Hansestadt für einen weit davor beginnenden und weit darüber hinaus reichenden Austausch und Kontakt. Über lange Jahrhunderte (bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts) handelte man mit Kolonien, ehemaligen Kolonien oder Kolonialmächten, kaufte oder verkaufte Kolonialwaren (und auch Menschen).
Alle Vorträge der Vorlesungsreihe finden Sie auf der Lecture2Go-Plattform unter: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4702.
Als erste deutsche, ja europäische Metropole widmet sich die Hansestadt aber seit dem Jahr 2014 auch offiiziell der Aufarbeitung dieser Vergangenheit und richtete dazu die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe/Hamburg und die frühe Globalisierung“ ein. In der Ringvorlesung präsentiert die Forschungsstelle erste Ergebnisse ihrer Arbeit, erläutert exemplarische Erinnerungsorte und diskutiert Themen und Probleme der Auseinandersetzung mit dieser schwierigen Vergangenheit.
Die Vorlesung findet ab dem 20.4.2016 in Kooperation mit dem Verein für Hamburgische Geschichte statt. Weitere Informationen und Terminaktualisierungen finden Sie auf http://www.kolonialismus.uni-hamburg.de/ .
20.04.2016
Von den „Askari-Reliefs“ zur Speicherstadt
Prof. Dr. Jürgen Zimmerer, Arbeitsbereich Globalgeschichte, Universität Hamburg
27.04.2016
Anerkennung und Entschuldigung. Die außenpolitische Dimension postkolonialer Erinnerung
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin a.D.
04.05.2016
Deutsche Sklavenhändler der Atlantic Slavery
Prof. Dr. Michael Zeuske, Universität zu Köln
11.05.2016
keine Aufzeichnung
18.05.2016 Pfingstferien
25.05.2016
Der Hamburger Hafen in Welthandel und Globalisierung
Prof. Dr. Dirk van Laak, Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität Gießen
01.06.2016
Keine Aufzeichnung
08.06.2016
Hamburg und die Gründung des deutschen Kolonialreichs unter Bismarck
Kim Sebastian Todzi, M. A., Arbeitsbereich Globalgeschichte, Universität Hamburg
15.06.2016
Vom Hamburger Kolonialinstitut zur Universität
Prof. Dr. Rainer Nicolaysen, Leiter der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte, Universität Hamburg
22.06.2016
Europa oder China – wo liegt die Mitte der Welt?
Prof. em. Dr. Wolfgang Reinhard, Universität Hamburg
29.06.2016
Das postkoloniale Erbe der Hafencity
Tania Mancheno, Dipl.-Pol., Universität Hammburg
06.07.2016
Die Dekolonisierung des Stadtbildes: Straßennamen zwischen Kolonialnostalgie und Perspektivumkehr
Joshua Kwesi Aikins, Universität Kassel
13.07.2016
Postcolonial Memory: A Shares Legacy: Tanzania-Germany
Dr. Oswald Masebo, University of Dar es Salaam
Mediennutzung im Wandel (Vorlesungsreihe)
Mediennutzung im Wandel
Koordination: Prof. Dr. Uwe Hasebrink, Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg.
Die Mediennutzung, also die Art und Weise, wie die Menschen mit den Medien umgehen, ist einem steten Wandel unterworfen. Treiber dieses Wandels waren und sind in den letzten Jahren insbesondere technische Innovationen, die sich unter den Schlagworten Digitalisierung, Online- und Mobilkommunikation zusammenfassen lassen. In der Folge sind zudem neue Angebotsformen entwickelt worden, die den Nutzern neue Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen. Doch auch gesellschaftliche Entwicklungen tragen dazu bei, dass sich Mediennutzung verändert, so der demographische Wandel, veränderte Anforderungen des Alltags oder auch neue Zeitstrukturen. Für alle Medien- und Kommunikationsberufe ist es unerlässlich, sich ein möglichst realistisches Bild von den sich neu herausbildenden Formen der Mediennutzung zu machen, um ihre Angebote entsprechend darauf einzustellen.
Alle Vorträge, wenn nicht anders gekennzeichnet, von Prof. Dr. Uwe Hasebrink sind zu finden auf der Lecture2Go-Plattform unter: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/19194.
05.04.2016
Überblick, Organisatorisches
14.04.2016
Theoretische Grundlagen
19.04.2016
Methodische Grundlagen
26.04.2016
Keine Aufzeichnung
03.05.2016
Trends der Nutzung bei Einzelmedien: Zeitungen
Prof. em. Dr. Michael Haller, Universität Leipzig
10.05.2016
Trends der Nutzung bei den Einzelmedien (2): Fernsehen
17.05.2016
Pfingstferien
24.05.+01.06.2016
Keine Aufzeichnung
07.06.2016
Trends in der Nutzung von Einzelmedien: Online-Medien
14.06.2016
Nachrichtennutzung im Wandel: Der Reuters Institute Digital News Survey
Dr. Sascha Hölig, Hand-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg
21.06.2016
Medienwandel, Langzeitstudien Massenkommunikation
28.06.2016
Medien- und Informationsrepertoires
05.07.2016
Medienkonvergenz und neue Kommunikationsmodi: Formen der Bewegtbildnutzung
12.07.2016
Zusammenfassung
Refugees Welcome – aber wie? (Vortragsreihe, Di. 18–20 Uhr, ESA, Hörsaal K)
Refugees welcome – aber wie?
Qualifizierungsprogramm für Studierende, die sich freiwillig für Geflüchtete engagieren
Koordination: Cornelia Springer.
Das Studiendekanat GW setzt im Sommersemester 2016 sein zum Wintersemester 2015/16 gestartetes Pilotprogramm zur Qualifizierung von Studierenden, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, fort. Es soll die Studierenden fachlich auf ihre herausfordernde Tätigkeit vorbereiten und darüber hinaus Raum zum Erfahrungsaustausch, zu Kollegialer Beratung und zur Reflexion sowie ggf. zur Entwicklung von eigenen Projektideen bieten.
Alle Vorträge der Vorlesungsreihe finden Sie auf der Lecture2Go-Plattform unter: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/19576.
Die Studierenden erwerben ein Grundlagenwissen in ausgewählten Bereichen, die für ihre praktische ehrenamtliche Arbeit relevant sind. Die folgenden Bausteine bilden dabei die inhaltlichen Schwerpunkte: Grundlagen des Asyl- und Ausländerrechts, Umgang mit kultureller und sprachlicher Verschiedenheit, Organisations- und Kommunikationsstrukturen und Entscheidungsprozesse in Hamburger Behörden, Rollenverständnis von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit – Zuständigkeiten, Grenzen und Abgrenzung, grundlegende Werkzeuge für einen interaktiven, alltagsorientierten Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht, Vernetzung Koordination und Projektmanagement.
Das Pilotprogramm wird in Kooperation mit mehreren Fachbereichen der Fakultät für Geisteswissenschaften, einzelnen Fachbereichen aus anderen Fakultäten sowie verschiedenen in der Hamburger Flüchtlingsarbeit tätigen außeruniversitären Einrichtungen geplant und durchgeführt. Es soll kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut werden.
18.04.2016
Keine Aufzeichnung
25.04.2016
Keine Aufzeichnung
02.05.2016
Zunehmende Flüchtlingszahlen als Herausforderung für Behörden
Dr. Sabine Hain, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Stadt Hamburg
09.05.-13.06.2016
Keine Aufzeichnung
20.06.2016
Herkunftsregionen und Fluchtursachen
Sophia Wirsching, Brot für die Welt
27.06.2016
Salafistische Einflussnahme unter Flüchtlingen in Deutschland
Hazim Fouad, Landesamt für Verfassungsschutz Bremen
04.+11.07.2016
Keine Aufzeichnung
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2015/16
Digital Humanities (Vorlesungsreihe)
Digital Humanities
Koordination sowie alle Vorträge, wenn nicht anders gekennzeichnet, durch: Prof. Dr. Jan Christoph Meister, Institut für Germanistik / Fachbereich Sprache, Literatur, Medien I der Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Hamburg
Digitale Medien und Technologien sind heutzutage ein selbstverständlicher Bestandteil unserer privaten wie beruflichen Alltagspraxis. Allerdings bleiben wir dabei in den meisten Fällen bloße ‚User‘, das heißt: Anwender von Geräten (Smartphones, Tablets, Notebooks etc.) und Nutzer von Informationsinfrastrukturen (Internet, Datenbanken, Social Media). Wir verwenden Vorhandenes je nach Bedarf und Funktionalität - aber was eigentlich unsere Bedarfe sind und welche Funktionen wir jeweils benötigen, darüber haben zuvor bereits die Systementwickler und Ingenieure entschieden, die uns bei unserer Praxis beobachtet haben. Zumeist ist das, was dabei dann am Ende herauskommt, eigentlich nur eine Emulation – eine Nachbildung – traditioneller Verfahrensweisen: alter Wein in neuen Schläuchen. Dafür allerdings hip und in HD!
Auf analoge Weise hat sich während der letzten 20 Jahre auch im Alltag der Geisteswissenschaften die Nutzung digitaler Medien und Technologien etabliert: selten zielgerichtet und als eine bewusst geplante methodische Innovation, sondern eher als eine schrittweise Emulation traditioneller Praxis mit neuen technischen Mitteln. Die Vorlesung wird deshalb zunächst einen Überblick über die digitalen Technologien und Verfahren geben, die heute in unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie Archäologie, Sprachwissenschaften, Kunstgeschichte, Medienwissenschaften, Literaturwissenschaften, Musikwissenschaften etc. zum Einsatz kommen. Neben dieser Bestandsaufnahme und der Präsentation von Beispielanwendungen soll jedoch vor allen Dingen die Frage nach dem methodologischen und konzeptionellen Zugewinn thematisiert werden, den das neue Methodenparadigma der sog. ‚Digital Humanities‘ birgt oder bergen könnte. Zwei Thesen stehen dabei im Hintergrund: erstens, die Geisteswissenschaften sollten sich das neue Paradigma kritischer und selbstbewusster aneignen – Innovation, nicht Emulation traditioneller Praxis ist gefordert. Zweitens, der eigentlich Effekt des „Einzugs der Maschine in die Geisteswissenschaften“ ist konzeptioneller Natur: digitale Medien und Technologien, wenn sie reflektiert angewandt werden, erlauben uns die Bearbeitung von grundsätzlich neuen Forschungsfragen und eine neue Form des geisteswissenschaftlichen Forschens, die stärker als bisher auf Teamwork und Empirie setzt.
12.10.2015
„Digital Humanities“ oder vom Einzug der Maschine in die Geisteswissenschaften
19.10.2015
Vom TEXT zum INDEX oder Pater Roberto Busa entdeckt das digitale Prinzip
26.10.2015
Digital Humanities in der Praxis: Datenerfassung, Visualisierung, Interpretation
02.11.2015
Chancen und Grenzen der automatisierten Arbeit mit digitalen Textkorpora
09.11.2015
Die Scholarly Primitives der Geisteswissenschaften
16.11.2015
Digitale Textanalyse in der Praxis
23.11.2015
Multimediaforschung und digitale lingua franca
30.11.2015
„Collaborative Knowledge Production“ oder: vom gemeinsamen Urteilen mit und ohne Wörter
07.12.2015
Digital Humanities-Impulse für geisteswissenschaftliche Forschungen
14.12.2015
Digitale Korpusanalyse mit dem Verfahren der Social Network Analysis
21.12.+28.12.
Weihnachtsferien
04.01.2016
Wie Säcke voller Wörter - eine stylometrische Analyse zweier Werk
Mareike Schumacher, M.A., Institut für Germanistik /SLM I, Universität Hamburg und Prof. Dr. Jan Christoph Meister, Institut für Germanistik /SLM I, Universität Hamburg
11.01.2016
Cultural Memory & Digital Mediation: Three contrasting projects in Armenia, Australia and South Africa
Harald Short, Emeritus Professor of DIgital Humanities, King's College London, Visiting Professorial Fellow, Australian Catholic University
18.01.2016
efoto als living public culture - Digitales Kulturerbe in Hamburg
Rabea Kleymann, M.A., Institut für Germanistik / SLM I der Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Hamburg, Jacek Grzondziel, M.A., Institut für Germanistik / SLM I, Universität Hamburg
25.01.2016
Going digital - Vom Einzug des Computers in die Geistes- und Kulturwissenschaften
Auf den Punkt gebracht (Ringvorlesung, Do. 18:30–20 Uhr, ESA, Hörsaal K)
Auf den Punkt gebracht
Schuld und Sünde - überholte Themen der christlichen Religion?
Kordination: Prof. Dr. Christine Büchner, Institut für Katholische Theologie, Universität Hamburg
Theologinnen und Theologen jonglieren mit einer Vielzahl äußerst komplexer Begriffe. In Lehrveranstaltungen und im wissenschaftlichen Diskurs werden viele Begriffe stillschweigend vorausgesetzt, die bei näherer Betrachtung äußerst mehrdeutig und schwer zu fassen sind. Studieneinsteigerinnen und -einsteiger sowie Außenstehende können da schnell den Überblick verlieren. Zudem sind Missverständnisse im interdisziplinären Dialog praktisch vorprogrammiert.
Nicht allein aus einer didaktischen Perspektive besteht folglich dringender Handlungsbedarf. Die Theologie hat ein wesentliches Eigeninteresse daran, dass sie in den vielfältigen Dialogen, die sie sucht und pflegt, verstanden wird: zwischen den Religionen, Kulturen und den anderen Wissenschaften. Begriffe wie Sünde, Offenbarung, Heil und Gnade lassen sich aber ebenso wenig einfach in Umgangssprache übersetzen. Ihnen scheint ein Bedeutungsüberschuss zu eigen zu sein, der sich gegen eindimensionale Übersetzungsversuche sperrt (J. Habermas).
Im Rahmen dieser Ringvorlesung wollen Theologinnen und Theologen aus diesem Dilemma ausbrechen und die von ihnen geforderte Übersetzungspflicht annehmen. In Kurzvorträgen werden sie wesentliche Grundbegriffe der Theologie auf den Punkt bringen und anschließend diskutieren.
Es handelt sich bei dieser Vorlesung um eine Ringvorlesung mit lediglich vier Terminen:
29.10.2015
Sünde und Schuld - überholte Themen der christlichen Religion?
Prof. Dr. Ulrike Link-Wieczorek, Institut für Evangelische Theologie, Universität Oldenburg
26.11.2015
Von Gottes Gnade Sprechen in gnadenlosen Zeiten
Prof. em. Dr. Jürgens Werbick, Seminar für Fundamentaltheologie, Universität Münster
03.12.2015
Gerechtigkeit - Relationaler Schlüsselbegriff zum Verständnis der Bibel und eines Lebens in Versöhnung und Frieden
Prof. Dr. Fernando Enns, Fachbereich Evangelische Theologie, Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen, Universität Hamburg
17.12.2015
Ein theologischer Blick auf die Welt - Wenn Gott ins Spiel gebracht wird
Gerrit Spallek, M.A., Institut für Katholische Theologie, Universität Hamburg
Religion, Dialog und Wissenschaft (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr, ESA, Hörsaal C)
Religion, Dialog und Gesellschaft
Verstummte Dialoge zwischen Christen, Muslimen und Juden? Wie begegnen sich Religionen heute im globalen Kontext
Koordination: Dr. Carola Roloff / Prof. Dr. Wolfram Weiße, beide Akademie der Weltreligionen, Universität Hamburg / Prof. Dr. Michael Zimmermann, NumataZentrum für Buddhismuskunde, Universität Hamburg / Tibetisches Zentrum Hamburg e. V.
Seit gut zehn Jahren haben wir es mit tiefgreifenden Veränderungsprozessen zu tun. Neben einer fortschreitenden Säkularisierung gibt es ein Erstarken von Religion und religiösen Diskursen, vor allem im Blick auf das Judentum, den Islam, den Buddhismus und das Alevitentum, aber auch hinsichtlich neuer Ansätze im Christentum. Einer der Gründe für diese Veränderungen liegt in der durch Migration zunehmenden Präsenz von Religionen in unserer Gesellschaft, ein anderer liegt darin, dass sich Religionen zunehmend von der gesellschaftlichen Pluralisierung herausgefordert sehen und sich der Frage stellen müssen, wie sie andere Religionen und deren Mitglieder wahrnehmen. Dieser Frage geht die Ringvorlesung ebenso nach wie den damit verbundenen Veränderungen im wissenschaftlichen Bereich. Hier ist ein verstärktes Interesse ganz unterschiedlicher akademischer Disziplinen für das Themenfeld von Religionen und Dialog festzustellen. Diese Vielfalt wird in der Ringvorlesung aufgenommen. Neue Forschungsergebnisse werden präsentiert und auf den Prüfstand gestellt.
Die Ringvorlesung wird von der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg in Kooperation mit dem NumataZentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg organisiert. Bei den Vorträgen zum Buddhismus wird zudem mit dem tibetischen Zentrum Hamburg e.V. kooperiert.
19.10.2015
Verstummte Dialoge zwischen Christen, Muslimen und Juden? Wie begegnen sich Religionen heute im globalen Kontext.
Prof. Dr. Rainer Tetzlaff, Wisdom Professor of African and Development Studies, Jacobs University Bremen
26.10.2015
Buddhismus in modernen Kontexten. Zum Verhältnis von „Religion“ und „Wissenschaft“ aus religionswissenschaftlicher Sicht
Jun.-Prof. Adrian Hermann, Institut für Missions- Ökumene und Religionswissenschaften, Universität Hamburg
02.11.2015
Offenheit gegenüber religiös Anderen im Judentum und Christentum
Florian Jäckel, M.A., Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg und Andreas Markowsky, M.A., Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
09.11.2015
Interreligöse Hermeneutik und neue Ansätze in islamischer Theologie
Katja Drechsler, M.A., Akademie der Weltreligionen, Universität Hamburg und Prof. Dr. Thorsten Knauth, Universität Duisburg
16.11.2015
Gender als Prüfstein für einen zeitgenössischen Buddhismus
Dr. Carola Roloff, Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
23.11.2015
Keine Aufzeichnung
30.11.2015
Motivationen, Voraussetzungen sowie Potenziale und Grenzen interreligiöser Dialogpraxis aus Sicht der Hamburger Akteure
Mehmet Kalender, M.A., Didaktik der gesellschaftswissenschaftlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, Universität Hamburg
07.12.2015
Religiöse Quellen, gelebtes Alevitentum und Dialog. Aus der Sicht alevitischer Theologie
Jun.-Prof. Dr. Handan Aksünger, Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
14.12.2015
Religion und interkultureller Dialog aus ethnologischer Sicht
Prof. Dr. Gunther Dietz, Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
21.+28.12.2015
Weihnachtsferien
04.01.2016
Dialog im Klassenzimmer. Religionspädagogische Perspektiven
Dr. Dörthe Vieregge, Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg und Kim David Amon, M.A., Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
11.01.2016
The Transmission of Buddhism to the West
Prof. Dr. Jay Garfield, Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
Ästhetik des Wissens. Interkulturelle Modelle von Religion und Wissenschaft im Dialog mit buddhistischer Anthropologie
Prof. Dr. Michael von Brück, Institut für Evangelische Theologie der Universität München
Linguistikgeschichte (Ringvorlesung)
Linguistikgeschichte – Eine Einführung in sprachwissenschaftliche Theorien
Koordination sowie Vorträge von: Prof. Dr. Heike Zinsmeister und Prof. Dr. Ingrid Schröder, SLM I, Universität Hamburg.
Die Vorlesung soll einen Überblick über die wichtigsten sprachwissenschaftlichen Theorien vermitteln, die im Laufe der Geschichte der Disziplin „Linguistik“ / „Sprachwissenschaft“ ausgebildet wurden. Die einzelnen Theorien werden in ihren wissenschaftsgeschichtlichen Kontext eingebettet und in ihrer Wirkung aufeinander dargestellt. Dabei sind die zentralen Fragestellungen und Begrifflichkeiten zu erörtern. Die Reichweite der einzelnen Ansätze kann anhand von exemplarischen Analysen kritisch diskutiert werden.
13.10.2015
Einführung
20.10.2015
Die Frage nach dem Ursprung der Sprache
27.10.2015
Linguistiktheorien und Linguistikgeschichte
03.11.2015
Sprachliche Strukturen: Europäischer Strukturalismus - Saussure, Trbetzkoy, Jakobsen
10.11.2015
„Das sprachliche Zeichen“
17.11.2015
Metapherntheorien - Vom Sprachschmuck zum kognitiven Konzept
24.11.2015
Zeichenmodelle
01.12.2015
Sprachliche Funktionen II: Sprachhandlung und Kommunikationstheorien - Grice, Searle
08.12.2015
„How to do things with words“
17.12.2015
Keine Aufzeichnung
24.+31.12.2015
Weihnachtsferien
05.01.2016
Neuro- und Psycholinguistik: Kognitive Modelle von Sprachproduktion und Sprachverstehen - Levelt, Frederici
12.01.2016
Soziolinguistik und Stadtsprachenforschung
19.01.2016
Korpuslinguistik und computerlinguistische Anwendungen (Fillmore)
26.01.2016
Spracherwerbstheorien
Philosophische Zwickmühlen (Ringvorlesung)
Philosophische Zwickmühlen
Paradoxien, Dilemmata und andere ausweglos scheinende Probleme in der Philosophie
Koordination: Jan Claas / Prof. Dr. Benjamin Schnieder, Universität Hamburg.
Philosophen sehen sich immer wieder Zwickmühlen, unauflösbar scheinenden Problemen und Widersprüchen, ausgesetzt. Vernünftige Annahmen können über rationales Schließen zu absurden Ergebnissen führen. Theorien und logische Systeme, welche auf einleuchtenden Prinzipien beruhen, können versteckte Widersprüche enthalten. Zudem können wir uns Situationen ausgesetzt sehen, in welchen sich schlicht nicht entscheiden lässt, wie wir handeln sollen oder wer in einem Dissens recht hat.
Zwickmühlen begegnen uns in der Philosophie sowohl dort, wo sie höchst theoretisch ist, etwa als logische Paradoxien und Antinomien, als auch dort, wo sie uns sagen soll, wie wir moralisch richtig zu handeln haben, etwa als Dilemmata in Moraltheorien. Einige Zwickmühlen, wie die Antinomie des Lügners in all ihren Varianten, weisen über Jahrtausende eine beispiellose Karriere in der Philosophie auf; aber auch neuere Zwickmühlen, wie die Russelsche Antinomie, haben sich für die Entwicklung bestimmter Disziplinen als wegweisend herausgestellt. Nach wie vor können sich Philosophen kaum sicher sein, ob sich aus einer bewährten Theorie oder einem philosophisch wichtigen Begriff nicht doch eine Paradoxie oder ein Widerspruch ableiten lässt. Daher haben Zwickmühlen in der Philosophie einen besonderen Stellenwert. Oft bilden Sie den Prüfstein für Theorien, welche durch sie nicht selten zu Fall gebracht werden.
In der Ringvorlesung werden wir uns näher mit einigen Zwickmühlen aus unterschiedlichen Bereichen der Philosophie beschäftigen. Wir werden nicht nur bestimmte Zwickmühlen näher kennen lernen, sondern auch etwas über ihre Geschichte erfahren und sehen, was wir aus Zwickmühlen lernen und wie wir mit ihnen umgehen können.
11. November 2015
Unlösbare Meinungsverschiedenheiten und die Objektivität der Moral
PD Dr. Manfred Harth, Ludwig-Maximilians-Universität München
25. November 2015
Keine Aufzeichnung
9. Dezember 2015
Moralische Dilemmata: ein Ding der (logischen) Unmöglichkeit?
PD Dr. Michael Kühler, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
6. Januar 2016
Paradoxien des Wissens
Prof. Dr. Elke Brendel, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
20. Januar 2016
Paradoxes of Signification
Prof. em. Dr. Stephen Read, University of St. Andrews
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2015
Weisheit. Alte Traditionen wieder aktuell (Ringvorlesung, Di. 18–20 Uhr, ESA Ost, Raum 221)
Weisheit: Alte Traditionen, wieder aktuell
Weisheit ist ein Thema, das Menschen in allen Kulturen und Religionen seit jeher beschäftigt hat. Es gibt in vielen Kulturen Übereinstimmung darüber, wer für weise gehalten wird: Weisen wird zugeschrieben, dass sie sich selbst und andere auf einer tieferen Ebene verstehen, gelassen und besonnen sind und anderen Menschen mit Wohlwollen begegnen. In den buddhistischen Traditionen ist Weisheit ein zentrales Element. Die Buddhas gelten als Verkörperung der Weisheit. Durch das Erkennen der Wirklichkeit und der abhängigen Natur der Phänomene lässt sich der zu Anhaften und Leiden führende Charakter des samsarischen Geistes durchschauen. Es wird eine Vielzahl meditativer Übungen gelehrt, um Leiden und Leidensursachen mit Hilfe von Weisheit zu überwinden. Manche dieser Praktiken werden auch im Westen in einem säkularen Kontext weitergegeben, etwa Achtsamkeit, Vipassana oder Zen.
Seit einigen Jahren rückt das Thema in den Fokus gesellschaftlichen Interesses. Meditation als Methode, Weisheit zu entwickeln, wird neurowissenschaftlich erforscht. In Studien zur Achtsamkeitspraxis konnte nachgewiesen werden, wie sich Körper und Geist verändern, wenn Menschen ihre Aufmerksamkeit nach innen richten. Festgestellt wurde z. B. der Abbau von Stresshormonen, der Aufbau von grauer Substanz im Gehirn sowie subjektiv bei den Praktizierenden mehr Klarheit, Ruhe und Wohlbefinden.
Interdisziplinäre Kongresse widmen sich der Neuroplastizität, also der Fähigkeit des Gehirns, sich bis ins hohe Alter hinein zu verändern, und erörtern die Natur des Bewusstseins und die Möglichkeiten, Bewusstsein zu schulen.
In der Psychologie gibt es den relativ neuen Zweig der empirischen Weisheitsforschung. Sie geht der Frage nach, welche Kompetenzen man braucht, um mit den großen Problemen des Menschseins umzugehen. Weisheit wird als ein wesentlicher Faktor von Resilienz angesehen.
Die sogenannten Weisheitstherapien stärken die Qualität, schwierige Lebenssituationen gut zu bewältigen. Sie vermitteln Fähigkeiten, die auch im Buddhismus eine Rolle spielen, z. B. Perspektivwechsel, Empathiefähigkeit und Emotionsregulation, also eigene Gefühle erkennen und differenzieren zu können. Erfahrungen mit Patienten zeigen, dass nach einem solchen Training Lebensfragen „weiser“ beurteilt werden.
Die Weisheitsforschung hat sich aus der Lebensspannenforschung und Gerontopsychologie entwickelt. Der deutsche Entwicklungspsychologe und Gerontologe Paul Balthes (1939–2006) war auf diesem Gebiet weltweit führend. Mit der voranschreitenden Alterung der Bevölkerung stellte er die Frage, welche positiven Entwicklungspotenziale das Alter hat und ob alte Menschen auch weise Menschen sind bzw. worin die Weisheit des Alters liegen könnte.
Die Vortragsreihe spannt den Bogen von den buddhistischen Weisheitstraditionen zu den neuen Ansätzen, Weisheit in der westlichen Gesellschaft zu verankern. Es geht um die Fragen: Welche Wege gibt es, das Leben zu meistern? Welche Eigenschaften kennzeichnen weise Menschen und wie kann man Weisheit erlernen?
Die Vorlesung ist eine Kooperationsveranstaltung des Numata Zentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg mit dem Netzwerk Ethik Heute.
Weitere Informationen:
www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de
www.ethik-heute.org
05.05.2015
(Achtung: Von-Melle-Park 8, Anna-Siemsen-Hörsaal)
Neue Perspektiven der Weisheitsforschung
Gert Scobel, Philosoph, Journalist
19.05.2015
Psychologische Weisheitskonzepte und ihre Nutzbarmachung in der Psychotherapie
Prof. Dr. Michael Linden, Charité, Universitätsmedizin Berlin
02.06.2015
Weisheit und Lebenspraxis: Die Lehren des Buddha, des griechisch-römischen Stoizismus und die Frage der wechselseitigen Beeinflussung
Prof. Dr. Jens Schlieter, Institut für Religionswissenschaft, Universität Bern, Schweiz
16.06.2015
Psychologie der Weisheit: Definitionen, Messversuche und viele offene Fragen
Prof. Dr. Judith Glück, Institut für Psychologie, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österrreich
Koordination:
Prof. Dr. Michael Zimmermann, Numata Zentrum für Buddhismuskunde, Fachbereich Asien-Afrika-Wissenschaften, Universität Hamburg / Birgit Stratmann, Netzwerk Ethik heute gGmbH
Ort und Zeit:
Dienstags, 18–20 Uhr, Hauptgebäude, Flügel Ost, Edmund-Siemers-Allee 1, Raum 221
Zeitgenössische Hamburger Theaterlandschaften (Ringvorlesung, Mi. 18–20 Uhr, Phil A)
Zeitgenössische Hamburger Theaterlandschaften. Selbstzeugnisse – Dramaturgien – Konzepte
Der Name Hamburg verweist in der Theatergeschichte nicht nur auf eine außerordentlich lebendige und vielfältige Theaterlandschaft. Seit dem ersten „Hamburger Theaterstreit“ der 1670er und -80er und dem zweiten der späten 1760er Jahre steht der Name auch für die intensive öffentliche Diskussion über den gesellschaftlichen Ort und die Funktion des Theaters. Durch Lessings berühmt gewordene „Hamburgische Dramaturgie“ aus den 1760ern ist der Name außerdem mit übergreifenden programmatischen wie konzeptionellen Ansprüchen an das Theater verbunden, nach dem Scheitern der zugehörigen „Hamburger Entreprise“ auch mit dem Zusammenstoß dieser Ansprüche mit der schnöden (nicht zuletzt finanziellen) Wirklichkeit.
Diesen historischen Hintergrund nimmt die Ringvorlesung zum Anlass, nach der aktuellen Lage der Hamburger Theaterorte und Theaterinstitutionen zu fragen. Auch in gegenwärtigen Debatten in Hamburg und darüber hinaus werden die gesellschaftliche Funktion und die programmatische Ausrichtung des Theaters angesichts der Konkurrenz durch andere („neue“) Medien und knapper öffentlicher Kassen wieder intensiv diskutiert. In der Vorlesungsreihe treten Vertreterinnen und Vertreter der Hamburger Theater mit der akademischen und nicht-akademischen Öffentlichkeit in den Dialog. Zu Wort kommen vor allem das Sprech- und Performancetheater: von den städtischen Bühnen über die Privattheater bis hin zu kleineren „Off“-Bühnen. Vorgestellt werden die Spielpläne sowie die dramaturgischen Programmatiken und Konzepte, die den jeweiligen Projekten zugrunde liegen. Unter welchen Bedingungen werden diese in die Praxis umgesetzt? Welche Rolle spielt dabei die Verortung in Hamburg? Gerahmt wird die Vorlesungsreihe durch akademische Beiträge, Respondenzen und eine abschließenden Podiumsdiskussion.
08.04.2015
Einführung
Prof. Dr. Martin Jörg Schäfer, Institut für Germanistik, Universität Hamburg
15.04.2015
Deutsches Schauspielhaus
Dr. Jörg Bochow, leitender Dramaturg
22.04.2015
Hamburger Kammerspiele / Altonaer Theater
Anja Del Caro, B.A., Chefdramaturgin
29.04.2015
Internationale Kulturfabrik Kampnagel
Nadine Jessen, Dramaturgin
06.05.2015 (keine Aufzeichnung!)
Ernst Deutsch Theater
Stefan Kroner, M. A., Dramaturg
13.05.2015
Fundus Theater
PD Dr. Sibylle Peters, Leiterin des Forschungstheater-Programms im FUNDUS THEATER Hamburg, HafenCity Universität Hamburg
20.05.2015
Ohnsorg-Theater
Cornelia Ehlers, Dramaturgin
03.06.2015
Thalia Theater
Beate Heine, M. A., geschäftsführende Dramaturgin
10.06.2015
St. Pauli-Theater
Ulrich Waller, Direktion und künstlerischer Leiter
17.06 .2015
Hamburg-Off / Lichthof-Theater
Matthias Schulze-Kraft, künstlerischer Leiter
24.06.2015
Komödie Winterhuder Fährhaus
Michael Lang, Leiter
01.07.2015
Schmidt Theater & Schmidts Tivoli Hamburg Reeperbahn
Mirko Bott, Programmchef
08.07.15
Gespräch zum aktuellen Ort des Theaters im Zeichen der Medienkonkurrenz
Prof. Dr. Ortrud Gutjahr, Institut für Germanistik, Universität Hamburg / Dr. Isabell McEwen, Freie Regisseurin, Hamburg / Dr. Karin Nissen-Rizvani, Dramaturgin Stadttheater Bremerhaven / Barbara Schmidt-Rohr, Dachverband freier Theaterschaffender Hamburg
Moderation: Ewelina Benbenek(M.A.)
Koordination:
Prof. Dr. Martin Jörg Schäfer, Institut für Germanistik, Universität Hamburg
Ort und Zeit:
Mittwochs, 18–20 Uhr, Philosophenturm, Von-Melle-Park 6, Hörsaal A
Wie weiter mit...? Klassiker der Philosophie und Probleme der Gegenwart (Ringvorlesung, Mi. 18–20 Uhr, Phil D)
Klassiker der Philosophie und Probleme der Gegenwart
Die akademische Philosophie zeichnet sich durch eine Vielfalt an Themen, Methoden und Traditionen aus, die teils stark voneinander abweichen. Wird diese innere Pluralität nicht als Manko begriffen, lässt sich die Frage stellen, ob nicht gerade der Reichtum an unterschiedlichen Perspektiven das Potenzial birgt, aktuelle Probleme in einem „neuen“ Licht zu betrachten.
In der Ringvorlesung soll ausgehend von konkreten Problemen ein Dialog mit historischen Positionen hergestellt werden: Trägt die Auseinandersetzung mit klassischen Denkerinnen und Denkern der Philosophie dazu bei, uns in den komplexen Zusammenhängen der Gegenwart mit ihren spezifischen Problemen zu orientieren? Suchen wir ganz bewusst das Gespräch mit ihnen – ohne dabei unser eigenes Anliegen aus dem Blick zu verlieren – gelingt es uns möglicherweise, unsere Probleme besser zu qualifizieren, Fehlerquellen und Sackgassen frühzeitig zu erkennen und auf diese Weise zu neuen Lösungsansätzen zu gelangen.
08.04.2015
Wie weiter mit Aristoteles?
Prof. Dr. Christof Rapp, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, Arbeitsbereich Antike Philosophie und Rhetorik, Ludwig-Maximilians-Universität München
22.04.2015
Kants Theorie der Redefreiheit – Gründe und Grenzen
Prof. Dr. Peter Niesen, Fachbereich Sozialwissenschaften, Universität Hamburg
06.05.2015
Nietzsche als freier Geist
Prof. Dr. Volker Gerhardt, Institut für Philosophie, Humboldt-Universität zu Berlin
20.05.2015
Ernst Cassirer – eine Philosophie der Freiheit
Prof. Dr. Birgit Recki, Philosophisches Seminar, Arbeitsbereich Praktische Philosophie, Universität Hamburg
10.06.2015
Wie weiter mit der Philosophischen Anthropologie von Helmuth Plessner?
Prof. Dr. Hans-Peter Krüger, Institut für Philosophie, Arbeitsbereich Politische Philosophie / Philosophische Anthropologie, Universität Potsdam
24.06.2015 Titeländerung/Referentenänderung
Karl Marx. Der lange Schatten eines Gespensts
Prof. Dr. Michael Quante, Philosophisches Seminar, Arbeitsbereich Philosophie mit dem Schwerpunkt Ethik und Praktische Philosophie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Marx als Gesellschaftskritiker und -diagnostiker
Prof. Dr. Georg Lohmann vom Philosophischen Institut der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
01.07.2015
(Achtung: 16–18 Uhr, Hauptgebäude, Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal A)
Geschichtsphilosophie nach Horkheimer und Adorno? Zur Aktualität der Dialektik der Aufklärung
Vertr.-Prof. Dr. Arnd Pollmann, Philosophisches Seminar, Arbeitsbereich Praktische Philosophie, Universität Hamburg
Koordination:
Paul Kindermann / Mina Wagener, betreut von Prof. Dr. Benjamin Schnieder und Vertr.-Prof. Dr. Arnd Pollmann, alle Philosophisches Seminar, Universität Hamburg
Ort und Zeit:Mittwochs, 18–20 Uhr, Philosophenturm, Von-Melle-Park 6, Hörsaal D
Mesoamerikanistik (Ringvorlesung, Teil 4, Do. 18–20 Uhr, Stabi Vortragsraum 1. OG)
Kulturelle Identitäten im Spiegel gesellschaftlicher und politischer Prozesse
Was wissen wir eigentlich über Mesoamerika? Und woher stammt unser Wissen? Wie dachten und was beobachteten beispielsweise die ersten Missionare in Neuspanien, wie beurteilten und wie beeinflussten die kirchlichen und staatlichen Institutionen im 16. und 17. Jahrhundert die indigene Bevölkerung in den ihnen unterstellten Gebieten? Wie nahmen die ersten Reisenden und Forscher ab dem späten 18. und besonders im 19. Jahrhundert die Menschen und ihre Lebenswelten im heutigen Mexiko, in Guatemala, in Belize und Honduras wahr? Und welche Erkenntnisse erlangten sie über die vorspanische Vergangenheit? Welchen Anteil hatten seither die Indigenen selbst, und welche Rolle spielen indigene Akteure heute in Religion, in gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Prozessen?
Der letzte Teil der Ringvorlesung zur Mesoamerikanistik möchte einen Einblick geben in die verschiedenen Quellen, die zu Mesoamerika existieren. Die Vielfalt reicht von frühkolonialen, indigen beeinflussten Codexbüchern und lateinschriftlichen Dokumenten bis zu Reiseberichten; sie beeinhaltet orale Traditionen und archäologische Aufzeichnungen und schließt auch die Neuen Medien mit ein.
15.05.15–28.06.15
Zeitreise zu den Azteken und Maya. Zum 50. Jubiläum der Mesoamerikanistik in Hamburg
Ausstellung ausgewählter literarischer Quellen zu Mesoamerika in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
(Achtung: Mittwoch)
„Indigene Christianisierung“ und „Criollismo“ in Neuspanien
Prof. Dr. Horst Pietschmann, Fachbereich Geschichte, Universität Hamburg
30.04.2015
Rigoberta Menchú. Macht der Wahrheit. Wahrheit der Macht
Prof. Dr. Ulrich Mücke, Fachbereich Geschichte, Universität Hamburg
07.05.2015
Besiedlung und Migration in Mesoamerika – Mythos und Modell
Prof. Dr. Viola König, Ethnologisches Museum, Freie Universität zu Berlin
14.05.2015 Terminwechsel
13.05.2015
Zeitreise zu den Azteken und Maya. Eröffnung der Ausstellung
Miriam Heun, M.A., Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde, Universität Hamburg
21.05.2015 - Referententausch, Thementausch
Von Humboldt bis Charnay. Amerika-Forscher und ihre Reisen im 19. Jahrhundert
Christian Brückner, M. A., Kunsthistorisches Seminar, Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde, Universität Hamburg
Auf den Spuren Eduard Selers: Neue archäologische Forschungen zur Region Chaculá, Guatemala
Dipl.-Inf. Ulrich Wölfel, M.A., Abteilung für Altamerikanistik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
28.05.2015 - Referententausch, Thementausch
Auf den Spuren Eduard Selers: Neue archäologische Forschungen zur Region Chaculá, Guatemala
Dipl.-Inf. Ulrich Wölfel, M.A., Abteilung für Altamerikanistik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Von Humboldt bis Charnay. Amerika-Forscher und ihre Reisen im 19. Jahrhundert
Christian Brückner, M. A., Kunsthistorisches Seminar, Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde, Universität Hamburg
11.06.2015
Das Werden von Friedensstiftern – Interview-Analysen von religiösen Friedensakteuren in Guatemala
Tamara Candela, M. A., Fachbereich Soziologie, Graduate School in History and Sociology, Universität Bielefeld
18.06.2015
(Achtung: Ausstellungsraum, Erdgeschoss)
Schätze für die Forschung – Ausgewählte
Exponate der Linga-Bibliothek in der Ausstellung „Zeitreise zu den Azteken und Maya“
Dr. Wiebke von Deylen, Linga-Bibliothek, Universität Hamburg
02.07.2015
Monotheismus trifft Polytheismus – Die aztekische Religion aus Sicht eines Christenmenschen des 16. Jahrhunderts
Dirk Tiemann, M. A., Fachbereich Geschichte, Universität Hamburg
Koordination:
Christian Brückner, M. A. / Dr. Claudine Hartau / Prof. em. Dr. Ortwin Smailus, alle Mesoamerika-Gesellschaft Hamburg e. V. in Kooperation mit der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Ort und Zeit:
Donnerstags, 18–20 Uhr, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Carl von Ossietzky, Von-Melle-Park 3, Raum HG 154
1945 – Das Ende des Zweiten Weltkriegs. (Ringvorlesung, Do. 18.30–20 Uhr, ESA 1, Hörsaal J)
1945 – das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Epochenwechsel
Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren nehmen die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH) und das Historische Seminar der Universität Hamburg zum Anlass für eine gemeinsame Ringvorlesung, in der die Folgen des Zweiten Weltkriegs aus deutscher, europäischer und globaler Perspektive betrachtet werden.
Das Weltkriegsende markiert einen Epochenwechsel. In einer sozialhistorischen Perspektive ist das durch den Zweiten Weltkrieg geteilte 20. Jahrhundert in eine „katastrophische“ und eine „goldene“ Hälfte geteilt worden (Eric Hobsbawm). Nach einer kurzen Phase gemeinsamer alliierter Politik nach 1945 prägte ein neues System des Kalten Krieges für ein halbes Jahrhundert die internationalen Beziehungen, aber auch die innenpolitischen Ordnungssysteme: im Westen eine von den USA dominierte demokratisch-kapitalistische Ordnung und ein von der Sowjetunion beherrschter Sozialismus im Osten.
In der Ringvorlesung steht die These des mit dem Jahr 1945 verbundenen Epochenwechsels im Mittelpunkt und wird anhand verschiedener thematischer Zusammenhänge diskutiert: die Schicksale der Opfer von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg, der Komplex von Zerstörung und Wiederaufbau, die Erfahrungswelten von Kriegs- und Besatzungskindern, enorme Migration wie Zwangsmigration, aber auch die Dekolonialisierung. Die Analyse der Folgen des Krieges sowie der neuen wirtschaftlichen und politischen Ordnungen der Welt verweist dabei stets auf Kontinuitäten aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, die das zeitgenössische Geschehen erst verstehen lassen.
09.04.2015
Kriegsende 1945? Das lange Ende des Zweiten Weltkriegs
Prof. Dr. Bernd Wegner, Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Helmut-Schmidt Universität der Bundeswehr Hamburg
16.04.2015
Besatzungsregime: Deutschland, Österreich, Japan
Prof. Dr. Christoph Cornelißen, Historisches Seminar, Goethe-Universität Frankfurt am Main
30.04.2015
Menschen in Bewegung: Wandel und Kontinuitäten von Migrationsregimen nach 1945
Prof. Dr. Claudia Kraft, Historisches Seminar, Universität Siegen
07.05.2015
Zerstörungen: Eine Bilanz des europäischen Bombenkriegs
Prof. Dr. Jörg Arnold, Department of History, University of Nottingham, England
21.05.2015
„Bankert!“ Besatzungskinder in Deutschland nach 1945
Prof. Dr. Silke Satjukow, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
04.06.2015
Mythos „Trümmerfrauen“: Die Geschichte eines deutsch-deutschen Erinnerungsortes
Dr. Leonie Treber, Kompetenzentwicklung durch interdisziplinäre Vernetzung von Anfang an (KIVA), Technische Universität Darmstadt
11.06.2015
Vom Weltkrieg zum Kalten Krieg – Entmilitarisierung und Aufrüstung im Atomzeitalter
Dr. Claudia Kemper, Hamburger Institut für Sozialforschung
18.06.2015
Vor dem Schuldgebirge. Die deutsche Gesellschaft im Sommer 1945
Prof. Dr. Norbert Frei, Historisches Institut, Friedrich-Schiller-Universität Jena
25.06.2015 - Termintausch mit 02.06.2015
Rückkehr ins Land der Täter: Recht und Gerechtigkeit in der frühen Nachkriegszeit. Gespräch und Lesung mit der Autorin Ursula Krechel aus ihrem Roman „Landgericht“ (2012)
Dekolonisierung 1945 – Aufbruch im globalen Süden
Prof. Dr. Marc Frey, Historisches Institut, Universität der Bundeswehr München
02.07.2015 - Termintausch mit 25.06.2015
Dekolonisierung 1945 – Aufbruch im globalen Süden
Rückkehr ins Land der Täter: Recht und Gerechtigkeit in der frühen Nachkriegszeit. Gespräch und Lesung mit der Autorin Ursula Krechel aus ihrem Roman „Landgericht“ (2012)
Moderation: Dr. Miriam Rürup, Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Universität Hamburg
08.07.2015
(Achtung: Mittwoch, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Beim Schlump 83, Lesesaal)
Podiumsdiskussion: Die Erinnerung an 1945 in den Medien 2015 oder was bleibt?
Diskutanten: Prof. Dr. Frank Bösch, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam / Dr. Magnus Brechtken, Institut für Zeitgeschichte, München / Prof. Dr. Axel Schildt, Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Universität Hamburg
Moderation: Stefan Reinecke (taz)
Koordination:
Prof. Dr. Birthe Kundrus, Historisches Seminar, Universität Hamburg / PD Dr. Lu Seegers, Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg
Ort und Zeit:
Donnerstags, 18.30–20.00 Uhr, Hauptgebäude, Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal J
Frank Bajohr und Jürgen Matthäus: Alfred Rosenberg. Die Tagebücher von 1933-1944. (Einzelvortrag, 23.4.15, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg)
Frank Bajohr und Jürgen Matthäus: Alfred Rosenberg.
Die Tagebücher von 1934-1944
Die Aufzeichnungen des NSDAP-Chefideologen
Buchpräsentation und Diskussion
Eine gemeinsame Veranstaltung der Forschungsstelle für Zeitgeschichte (FZH) und des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden (IGdJ)
Seit 1946 verschollen, wurden die Tagebücher des NSDAP-Chefideologen Alfred Rosenberg erst vor kurzem aufgefunden. Rosenbergs Aufzeichnungen zeigen, dass seine Rolle bei der Vorbereitung und Umsetzung des Holocaust lange unterschätzt wurde. Schon früh einer der radikalsten Antisemiten, unterstützte er bis zuletzt die deutsche Vernichtungspolitik. Rosenbergs Notizen verdeutlichen neben seiner unbedingten Ergebenheit gegenüber Hitler die erbitterte Konkurrenz innerhalb der Funktionselite um den „Führer“. Dieser wusste seine Entourage wirkungsvoll gegeneinander auszuspielen, nicht zuletzt Alfred Rosenberg und Joseph Goebbels, die einander in inniger Abneigung verbunden waren. Insgesamt eröffnet dieses Schlüsseldokument wichtige Einblicke in die vom NS-Regime erzeugte Gewaltdynamik.
Die Herausgeber Frank Bajohr (Zentrum für Holocaust-Studien am IfZ München) und Jürgen Matthäus (US Holocaust Memorial Museum) stellen die nun erstmals als Gesamtausgabe vorliegenden Aufzeichnungen Alfred Rosenbergs vor.
Begrüßung:
Miriam Rürup (Institut für die Geschichte der deutschen Juden)
Moderation:
Christoph Strupp (Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg)
Ort und Zeit:
Donnerstag, 23. April 2015, 18.30 Uhr
Lesesaal, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Beim Schlump 83, 20144 Hamburg
Thomas Honegger: From Fafner to Smaug: Dragons on the Silver Screen (Einzelvortrag, 10.7.15)
From Fafner to Smaug: Dragons on the Silver Screen
Sie sind das „Leitfossil“ des Fantasyfilms: die Drachen. Und dank moderner Technik sehen sie in den Filmen von heute deutlich lebendiger aus als dieses Abbild aus dem Jahr 1665. Zum Abschluss der studentischen Konferenz „Film in the 21st Century“ nimmt der Anglist Prof. Dr. Thomas Honegger von der Uni Jena euch in seinem Vortrag „From Fafner to Smaug: Dragons on the Silver Screen” mit auf eine Reise durch die aktuelle Fantasy-Filmlandschaft.
Ort und Zeit:
ESA Ost, Raum 221
Freitag, 10.07., um 18:30 Uhr
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2014/15
Medienkulturen des Dokumentarischen (Ringvorlesung, Teil 2, Mo. 18–20 Uhr, Phil D)
Koordination: Prof. Dr. Thomas Weber, Institut für Medien und Kommunikation / Dr. Carsten Heinze, Fachbereich Sozial-
ökonomie, beide Universität Hamburg
13.10.2014
Einführung
Prof. Dr. Thomas Weber, Institut für Medien und Kommunikation / Dr. Carsten Heinze, Fachbereich Sozial-
ökonomie, beide Universität Hamburg
20.10.2014
Schnitte in Zeit und Raum
Gabriele Voss, Filmemacherin, Berlin / Witten
27.10.2014
(Geschichts-)Politiken des Dokumentarischen: Das Beispiel RAF
Dr. Christian Hißnauer, DFG-Projekt "Ästhetik und Praxis populärer Serialität", Georg-August-Universität
Göttingen
03.11.2014
Spuren. Beiträge zur Archäologie der realen Existenz
Prof. Thomas Heise, Filmemacher, Akademie der Bildenden Künste, Wien
10.11.2014 fällt aus!
Methoden des kulturanthropologischen Films
Dr. Edmund Ballhaus, Kulturwissenschaftler, Filmemacher, Göttingen
17.11.2014
Musik-Dokumentationen
Dr. Carsten Heinze, Fachbereich Sozialökonomie, Universität Hamburg
24.11.2014
Reality TV Revisited
Prof. Dr. Joan Kristin Bleicher, Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg
01.12.2014
Videographie. Die sozialwissenschaftliche Interpretation und Analyse von Interaktion mit
audio-visuellen Daten
Prof. Dr. Hubert Knoblauch, Institut für Soziologie, Technische Universität Berlin
08.12.2014
Dokumentarfilme der NS-Zeit: Ideologie im dokumentarischen Film des Dritten Reichs
Prof. Dr. Kerstin Stutterheim, Filmemacherin und Professur für AV-Dramaturgie und Ästhetik, Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf", Potsdam
15.12.2014
Gegen-Öffentlichkeit
Prof. Dr. Thomas Weber, Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg
05.01.2015
Der Essayfilm
Dr. Thomas Tode, Filmhistoriker, Hamburg
12.01.2015
"Im Kino der Humanwissenschaften": Dokumentarische Filme als Wissenschaftsfilme
Dr. Ramón Reichert, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Universität Wien
19.01.2015
Das Archiv und seine Lücke
Eva Knopf, M. A., Filmemacherin, DFG-Projekt "Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945–2005", Berlin
26.01.2015
Protagonisten in dokumentarischen Milieus
Prof. Peter Ott, Filmemacher und Professur für den Studienbereich Film und Video, Merz-Akademie Stuttgart
650 Jahre Messen in Hamburg (Ringvorlesung, Mi. 18–20 Uhr, ESA 1, Hörsaal J)
Koordination
Prof. i. R. Dr. Franklin Kopitzsch / Dr. Jörn Lindner, Lehrbeauftragter, beide Fachbereich Geschichte, Arbeits-
stelle für Hamburgische Geschichte, Universität Hamburg
08.10.2014
Projektvorstellung
Prof. i. R. Dr. Franklin Kopitzsch, Initiator des Projektes / Dr. Jörn Lindner, beide Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte, Universität Hamburg
Eine Zeitreise – Das mittelalterliche Messeprivileg und die Gewerbeschauen des 19. Jahrhunderts als Keim-
zelle der heutigen Messen
Prof. i. R. Dr. Franklin Kopitzsch, Fachbereich Geschichte, Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte,
Universität Hamburg
29.10.2014
Schaufenster zur Welt – Das hamburgische Messe- und Kongresswesen im turbulenten 20. Jahrhundert
Dr. Jörn Lindner, Lehrbeauftragter, Fachbereich Geschichte, Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte,
Universität Hamburg
05.11.2014
Leipziger Messe – Maximilian, Mustermesse, Marx und Marktwirtschaft
Martin Buhl-Wagner, Sprecher der Geschäftsführung, Leipziger Messe GmbH
19.11.2014
Messeland Deutschland – Größter Treffpunkt der Weltwirtschaft
Dr. Peter Neven, Geschäftsführer, Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V. (AUMA)
03.12.2014
650 Jahre Messen in Hamburg – Erfolgsfaktor für Wirtschaft, Stadt und Bürger
Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung, Hamburg Messe und Congress GmbH
14.01.2015
Exportschlager deutsche Messen
Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung, Messe Frankfurt GmbH
28.01.2015
Kurs Zukunft – Wohin steuert die Hamburg Messe und Congress GmbH?
Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung, Hamburg Messe und Congress GmbH
Theologie im Gespräch (Ringvorlesung, Do. 18–20 Uhr, ESA 1, Hörsaal J)
Koordination
Prof. Dr. Christine Büchner, Institut für Katholische Theologie, Universität Hamburg
16.10.2014
Katholische Theologie an der Universität Hamburg – Antrittsvorlesung und Eröffnung der Ringvorlesung
Prof. Dr. Christine Büchner, Institut für Katholische Theologie, Universität Hamburg
23.10.2014 wird nicht aufgezeichnet!
Theologie im Gespräch mit der Philosophie. Oder: Dem Glauben Vernunft eintreiben!
Prof. Dr. Magnus Striet, Theologische Fakultät, Arbeitsbereich Fundamentaltheologie, Universität Freiburg
30.10.2014 wird nicht aufgezeichnet!
Theologie im Gespräch mit Naturwissenschaften: alter Streit vor neuen Herausforderungen?
Prof. Dr. Johanna Rahner, Katholisch-Theologische Fakultät, Dogmatik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie, Eberhard-Karls-Universität Tübingen
06.11.2014
Theologie im Gespräch mit den Religionen I: "Christentum und Kirche nicht ohne Judentum: jüdisch-christlicher Dialog heute"
Prof. Dr. phil. h.c. Hans Hermann Henrix, Akademiedirektor a. D. der Bischöflichen Akademie des Bistums
Aachen
13.11.2014 wird nicht aufgezeichnet!
Theologie im Gespräch mit den Religionen II: der Dialog zwischen christlichen und muslimischen Theologen – aktueller Stand, Probleme und Perspektiven
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Rotraud Wielandt, Beraterin der Päpstlichen Kommission für religiöse Beziehungen zu den Muslimen und Institut für Orientalistik, Islamkunde und Arabistik, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
20.11.2014
Theologie im Gespräch mit den Religionen III: theologische Themen im christlichen Gespräch mit dem
Buddhismus
Prof. Dr. Ulrich Dehn, Fachbereich Evangelische Theologie, Institut für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaften, Universität Hamburg
27.11.2014
Theologie im Gespräch mit heutigem Atheismus. Gott – warum wir ihn (nicht) brauchen
Prof. em. Dr. Hans Kessler, Werther/Westf.; Fachbereich Katholische Theologie, Systematische Theologie,
Goethe-Universität, Frankfurt am Main
04.12.2014
(Achtung: Von-Melle-Park 6, Hörsaal F)
Theologie im Gespräch mit den Kirchen. Ökumene heute
Prof. Dr. Dorothea Sattler, Ökumenisches Institut, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
11.12.2014
Theologie im Gespräch mit aktuellen ethischen Fragen. Die Gewaltlatenz der Staatengemeinschaft als
Herausforderung für die politische Ethik
Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, Direktor, Institut für Theologie und Frieden, Hamburg
18.12.2014 wird nicht aufgezeichnet!
Theologie im Gespräch mit Schule. Zwischen Beheimatung und Begegnung – das Aufgabenspektrum des
Religionsunterrichts
Prof. Dr. Clauß Peter Sajak, Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Katholische Theologie und ihre
Didaktik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
08.01.2015
Theologie im Gespräch mit der Bibel. Auferstehung und andere Unmöglichkeiten
Prof. Dr. Sabine Bieberstein, Exegese des Neuen Testaments und Biblische Didaktik, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
15.01.2015 -- Referentenwechsel
Theologie im Gespräch mit der Kunst. Veraicon. Andacht und Avantgarde
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Alex Stock, Bildtheologische Arbeitsstelle, Universität zu Köln Prof. Dr. Reinhard Hoeps, Institut für Katholische Theologie und ihre Didaktik, Westfälische Wilhelms Universität
22.01.2015
Theologie im Gespräch mit der Literatur der Gegenwart
Prof. Dr. Georg Langenhorst, Katholisch Theologische Fakultät, Lehrstuhl für Didaktik des Katholischen
Religionsunterrichts und Religionspädagogik, Universität Augsburg
29.01.2015 wird nicht aufgezeichnet!
Theologie im Gespräch mit dem zeitgenössischen Mainstream- und Autorenfilm. Avatare und andere Erlöser
Prof. Dr. Joachim Valentin, Direktor des Katholischen Zentrums "Haus am Dom", Frankfurt am Main
Ajahn Brahm: Buddhismus 21. Jahrhundert (Einzelvortrag, So. 26.10.2014, 14–16 Uhr, VMP 8, Anna-Siemsen-Hörsaal)
John Pier: Narrative between Transmediality and Intermediality (Einzelvortrag, Do. 4.12.2014, 18 Uhr, Phil 1263)
Ingrid Schröder: Niederdeutsch in Hamburg. Zur Vernetzung von Wissenschaft, Kultur und Alltag (Einzelvortrag, 8.12.14, Mo. 16–18 Uhr, ESA1, Hörsaal J)
Themenwoche: Sozialistische Kinderwelten (19.01.–23.01.2015, Hamburg)
Sozialistische Kinderwelten: Literarische Streifzüge durch Polen, Russland und Slowenien
Lesungen - Diskussionen - Ausstellung
Koordination
Dr. Anna Artwińska, Prof. Dr. Anja Tippner, Dr. Katarzyna Różańska
Institut für Slawistik, Universität HAmburg
19.01.2015 12:00
Eröffnung der Austellung "Wie das Kinderbuch den Sozialismus erzählt" (19.01 - 15.03.2015)
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Von-Melle-Park 3, Gang zum Lichthof
20.01.2015 16:30
Lesung des Buches "Pink. Za mojo generacijo; dt. Pink. Für meine Generation"
Bücherhalle Altona, Ottensener Hauptstraße 10
20.01.2015 18:15
Lesung des Buches "Priklučenija Džerika; dt. Džeriks Abenteuer"
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Von-Melle-Park 3, Vortragsraum, 1. Etage
21.01.2015 14:00 - 16:00
21.01.2015 20:15
Lesung des Buches "Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci; dt. Grüne Orangen - eine polnische Kindheitserinnerung"
Heinrich Heine Buchhandlung e. G., Grindelallee 28
22.01.2015 18:00
Lesung des Buches "Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci; dt. Grüne Orangen - eine polnische Kindheitserinnerung"
23.01.2015 19:00
Lesung des Buches "Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci; dt. Grüne Orangen - eine polnische Kindheitserinnerung"
Residenz des Generalkonsuls der Republik Polen, Maria-Louisen-Str. 17
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2014
Medienkulturen des Dokumentarischen (Ringvorlesung, Mo. 18–20 Uhr Phil C)
Koordination: Prof. Dr. Thomas Weber, Institut für Medien und Kommunikation / Dr. Carsten Heinze, Fachbereich Sozialökonomie, beide Universität Hamburg
07.04.2014
Einführung
Prof. Dr. Thomas Weber, Institut für Medien und Kommunikation / Dr. Carsten Heinze, Fachbereich Sozialökonomie, beide Universität Hamburg
14.04.2014
Filme für die Erde: Der Dokumentarfilm als Anwalt des Nachhaltigkeitsdiskurses
Dr. Thomas Klein, Film- und Medienwissenschaftler, Mainz
28.04.2014
Dokumentarische Langzeitstudien
Vertr.-Prof. Dr. Britta Hartmann, Institut für Sprach-, Medien- und Musikwissenschaft, Universität Bonn
05.05.2014
Reality TV
Thomas Vallée, Fernsehproduzent, Berlin
12.05.2014
Dokumentarische Strategien zur Massentauglichkeit. Die Annäherung an den Spielfilm
Dr. Kay Hoffmann, HAUS DES DOKUMENTARFILMS, Stuttgart
19.05.2014
Dokumentarfilmisch arbeiten
Christoph Hübner, Filmemacher, Witten / Berlin
26.05.2014
Geschichte als Unterhaltungsformat im Fernsehen
Podiumsgespräch: Nico Hofmann, Filmproduzent (UFA FICTION), München / Prof. Dr. Thomas Weber, Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg / Dr. Carsten Heinze, Fachbereich Sozialökonomie, Universität Hamburg
02.06.2014
Film und Archiv. Geschichte und Ästhetik des Kompilationsfilms
Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann, DFG -Forschungsprojekt „Regionale Filmkultur in Brandenburg: Amateurfilmschaffen, Betriebsfilmstudio EKO Eisenhüttenstadt, HFF-Filmarchiv“, Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, Potsdam
16.06.2014
Die Kinowochenschau – zwischen dokumentarischem Film und aktuellen Nachrichten
Dr. Sigrun Lehnert, Hamburg Media School, Hamburg
23.06.2014
„Das Herakles Konzept“ – Dokumentarfilm zwischen Kunst und Macht
Lutz Dammbeck, Filmemacher und Medienkünstler, Hamburg
30.06.2014
Verhandlung der Vergangenheit. Film- und Fernsehdokumentationen über NS-Täter vor Gericht
Götz Lachwitz, M. A., DFG-Projekt „Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945–2005“, Universität Konstanz
07.07.2014
TanzRäume. Tanz im dokumentarischen Film
Dr. Cornelia Lund, DFG-Projekt „Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945–2005“, Universität Hamburg
montags 18-20 Uhr, Hörsaal C, Philosophenturm, Von-Melle-Park 6
Sprache – Diskurs – Kultur (Ringvorlesung, Do. 18–20 Uhr, Phil F)
Hinweis: Die Aufzeichnungen dieser Ringvorlesung sind nicht öffentlich zugänglich; URL und Zugangscode können jedoch bei Interesse bei den Veranstalterinnen oder im Geschäftszimmer der Slavistik erfragt werden (Kontaktdaten unter: https://www.slm.uni-hamburg.de/slavistik/kontakt.html).
Koordination: Prof. Dr. Marion Krause / Dr. Nadine Thielemann, beide Institut für Slavistik, Universität Hamburg
03.04.2014
Einführung in die Kulturwissenschaftliche Linguistik
Prof. Dr. Holger Kuße, Institut für Slavistik, Technische Universität Dresden
10.04.2014
Lifestyle in der Kommunikation (Kommunikationsbezogene Stratifikation der Gesellschaft)
Prof. Dr. Michael Fleischer, Institut für Journalismus und soziale Kommunikation, Universität Wrocław
17.04.2014
Sprache als kulturelles Phänomen – verbale und nonverbale Kommunikation in Russland
Dr. Gabriele Kötschau, IHK Hamburg / Sankt Petersburg
24.04.2014
Konventionelle und emanzipatorische Personenbenennungspraktiken in Kroatien und Serbien
Simone Rajilić, Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin
08.05.2014
Politainment? Inszenierungen in der russischen Politik
Prof. Dr. Beatrix Kreß, Institut für Interkulturelle Kommunikation, Universität Hildesheim
15.05.2014
Vatersnamen, Titelsucht und Globalisierung: Wie entwickelt sich die nominale Anrede in den slawischen Sprachen?
Prof. Dr. Bernhard Brehmer, Institut für Slawistik, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
22.05.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
Die Bedeutung von Interaktionsdaten für die Linguistik (am Beispiel des Polnischen)
Dr. Jörg Zinken, Department of Psychology, University of Portsmouth
05.06.2014
Das Gestern im Morgen: Traditionelle Implikationen im modernen russischen Wirtschaftsdiskurs
Prof. Dr. Renate Rathmayr, Institut für Slawische Sprachen, Wirtschaftsuniversität Wien
12.06.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
Studying Polish Politeness (in an Intercultural Context): Quantitative and Qualitative Approaches
Dr. Eva Ogiermann, Department of Education & Professional Studies, King’s College London
26.06.2014
Patriotyzm genetyczny, półka kulturowa und Palikotyzacja X-a – Schlagworte der PiSomowa und ihre diskursive Durchschlagskraft
Dr. Nadine Thielemann, Institut für Slavistik, Universität Hamburg
03.07.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
Identitätskonstruktionen in der russischen Wirtschaft
Dr. Edgar Hoffmann, Institut für Slawische Sprachen, Wirtschaftsuniversität Wien
10.07.2014
Wort, Diskurs, Konzept: „Leistung“ unter interkultureller Perspektive
Prof. Dr. Marion Krause, Institut für Slavistik, Universität Hamburg
Einführung in die Mesoamerikanistik II: Räume des Kontaktes in Mesoamerika (Ringvorlesung, Do. 18–20 Uhr Stabi, Raum HG 154)
Koordination: Prof. em. Dr. Ortwin Smailus, Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde, Universität Hamburg / Dr. Claudine Hartau / Christian Brückner, alle Mesoamerika-Gesellschaft Hamburg e. V.
10.04.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
Das Leben geht weiter. Neuspanien nach der Eroberung
Dr. Elke Ruhnau, Lehrbeauftragte am Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin
24.04.2014
Bilder der „Neuen Welt“: Die Wahrnehmung Neuspaniens im Europa des 16. Jahrhunderts
PD Dr. Hildegard Frübis, Institut für Kunst- und Bildgeschichte (IKB ), Humboldt-Universität zu Berlin
08.05.2014
Die Voladores de Papantla – ein sakrales Ritual wird UNESCO Weltkulturerbe
Svenja Schöneich, M. A., Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde, Universität Hamburg
22.05.2014
Das Versprechen des Kreuzes von Noh Cah Santa Cruz: Eine indianische Utopie im Licht der Wirklichkeit
Dr. Armin Hinz, Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde, Universität Hamburg
05.06.2014
Zwischen Tenochtitlan und Tilantongo: Der „Clash of Cultures“ in mesoamerikanischen Bilderhandschriften
Andrea Nicklisch, M. A., Historisches Seminar, Universität Hamburg
19.06.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
9.9.18.0.0 Uxul, Campeche – Geschichte, Archäologie und Gegenwart eines klassischen Maya-Zentrums
Dr. Kai Delvendahl, Abteilung für Altamerikanistik, Leiter des Archäologischen Projektes Uxul, Universität Bonn
03.07.2014 (Achtung: Raum HG 260, Staatsbibliothek)
Zurück zur Natur? Indigenität, Tourismus und Globalisierung in Mexiko
Prof. Dr. Eveline Dürr, Institut für Ethnologie, Ludwig-Maximilian-Universität München
10.07.2014 (fällt aus!)
Europäische Importe und indigene Entscheidungsprozesse – Kartographie und Ikonographie im kolonialen Mexiko und dem Andenraum
Prof. Dr. Viola König, Direktorin des Ethnologischen Museums Staatliche Museen zu Berlin, Honorarprofessorin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin
Hamburger Gastprofessur für Interkulturelle Poetik – Emine Sevgi Özdamar: Sprach-Rollen-Wechsel (Vorlesungsreihe, Do. 18–20 Uhr ESA 1, Hörsaal M)
Koordination: Prof. Dr. Ortrud Gutjahr (Institut für Germanistik: Neuere deutsche Literatur und Interkulturelle Literaturwissenschaft, Universität Hamburg)
03.04.2014
Sprach-Rollen-Wechsel: Wohin geht die Reise?
Begrüßung und einführende Lesung zur Poetikvorlesung
Gastprofessorin Emine Sevgi Özdamar
10.04.2014
Durch die Karawanserei der frühen Anfänge
Poetikvorlesung I (anschließend Diskussion)
Gastprofessorin Emine Sevgi Özdamar
24.04.2014
Über die Brücke in die deutsche Sprache
Poetikvorlesung II (anschließend Diskussion)
Gastprofessorin Emine Sevgi Özdamar
08.05.2014
In neuen Rollen unter seltsamen Sternen
Poetikvorlesung III (anschließend Diskussion)
Gastprofessorin Emine Sevgi Özdamar
15.05.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
"Karriere einer türkischen Putzfrau"
Emine Sevgi Özdamar zeigt Filmausschnitte und spricht über ihre Rollen.
Moderation: Prof. Dr. Ortrud Gutjahr, Universität Hamburg
22.05.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
Mit Emine Sevgi Özdamar durch ein Semester
Studierende stellen ihre Auseinandersetung mit dem Werk Emine Sevgi Özdamars vor und diskutieren mit der Autorin.
27. und 28.05.2014
Sprach-Rollen-Wechsel
Emine Sevgi Özdamars Interkulturelle Poetik
Internationale Tagung in Anwesenheit der Autorin
28.05.2014 (Wird nicht aufgenommen!)
Emine Sevgi Özdamar liest aus der Istanbul-Berlin-Trilogie und unveröffentlichten Texten
Die Autorin im Gespräch
Moderation: Prof. Dr. Ortrud Gutjahr, Universität Hamburg
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2013/14
Phonetics and Pronunciation – AE, Teil 1 (Vorlesung)
Koordination: Susannah Ewing Bölke, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Hamburg
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Mesoamerikanistik (Vorlesung, 24.10.2013 – 23.01.2014)
Koordination: Christian Brückner, M. A./ Prof. em. Dr. Ortwin Smailus, beide Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturkunde, Universität Hamburg
24.10.2013 – 23.01.2014 (6 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Nach der Katastrophe: Historische und literarische Narrative über den Holocaust in Osteuropa (Vorlesung, 23.10.2013 – 15.01.2014)
Koordination: Prof. Dr. Anja Tippner, Institut für Slavistik, Universität Hamburg / Prof. Dr. Frank Golczewski, Fachbereich Geschichte, Universität Hamburg
23.10.2013 – 15.01.2014 (9 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Fremde Sprache Freiheit. Exilschriftsteller im Gespräch (Vortrag, 27.11.2013)
Abbas Khider und Mahmood Falaki lesen aus ihren Texten und diskutieren mit Christa Schuenke und Madjid Mohit, Moderation: Prof. Dr. Doerte Bischoff, Institut für Germanistik, Universität Hamburg
27.11.2013 (1 Veranstaltungsreihe)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Podcasts produzieren: Studieren@Kultur
Koordination: Tatiana Samorodova, M.A., Natalia Brühl, M.A.
(1 Video)
Hinweis: Dieses Video finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2013
Andocken. Eine Hansestadt und ihre Kultur(en) – Teil VII (Vorlesung, 27.05.2013 – 01.07.2013)
Koordination: Prof. Dr. Franklin Kopitzsch, Historisches Seminar, Arbeitsstelle für Hamburgische Geschichte / Dr. Johanna Meyer-Lenz, Koordinatorin des FKGHH, Historisches Seminar /Myriam Richter, M. A., Institut für Germanistik II, alle Universität Hamburg
27.05.2013 – 01.07.2013 (3 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
John Stuart Mill und der Utilitarismus (Vorlesung, 03.04.2013 – 10.07.2013)
Koordination: Prof. Dr. Thomas Schramme, Fachbereich Philosophie, Arbeitsbereich Praktische Philosophie, Universität Hamburg
03.04.2013 – 10.07.2013 (5 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Vernetzte Öffentlichkeiten (Vorlesung, 04.04.2013 – 11.07.2013)
Koordination: Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Hans-Bredow-Institut, Universität Hamburg
04.04.2013 – 11.07.2013 (12 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Medien zwischen Markt und Staat – Teil 1 (Vorlesung, 29.04.2013 – 01.07.2013)
Koordination: Prof. Dr. Thomas Weber, Institut für Medien und Kommunikation, Universität Hamburg
29.04.2013 – 01.07.2013 (4 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Carl Friedrich von Weizsäcker-Vorlesungen – 2013 (Vorlesung,03.06.2013 – 07.06.2013)
Vortragender: Prof. Gabriele Veneziano
03.06.2013 – 07.06.2013 (5 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2012/13
Making the Real: Wie wird Wirklichkeit eigentlich gemacht? (Vorlesung, 16.10.2012 – 29.01.2013)
Koordination: Prof. Dr. Inke Gunia, Institut für Romanistik / Dr. Stephanie Neu, Institut für Germanistik II, beide Universität Hamburg
16.10.2012 – 29.01.2013 (10 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Carl Friedrich von Weizsäcker-Vorlesungen - 2012 (Vorlesung, 03.12.2012 – 07.12.2012)
Vortragender: Prof. Dagfinn Føllesdal
03.12.2012 – 07.12.2012 (5 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
SIRA/Surveillance Studies Lecture (Vortrag, 20.11.2012)
Vortragender: Prof. Dr. Francisco Klauser, Universität Neuchatei, Schweiz
20.11.2012 (1 Aufzeichnung)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2012
A Virtual Introduction to Science Fiction (Vorlesung, 03.04.2012 – 10.07.2012)
Koordination: Lars Schmeink, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Hamburg
03.04.2012 – 10.07.2012 (13 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Inherited Grief and the Healing Power of Storytelling (Lesung, 16.04.2012)
Koordination: Elizabeth Rosner
16.04.2012 (1 Aufzeichnung)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2011/12
Grenzverläufe (Vorlesung, 10.11.2011 – 02.02.2012)
Koordination: Prof. Dr. Marion Krause, Institut für Slavistik / Monika Pemic, Institut für Slavistik /Dagmar Bruss, Institut für Romanistik / Stephanie Neu, Institut für Romanistik, alle Universität Hamburg
10.11.2011 – 02.02.2012 (6 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Exil – Literatur – Judentum (Ringvorlesung, 17.10.2011 – 30.1.2012)
Koordination: Prof. Dr. Doerte Bischoff, Institut für Germanistik, Universität Hamburg
17.10.2011 – 30.1.2012 (14 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Konsum, Shoppen, Alltag, Kontrolle (Vorlesung, 20.10.2011 – 26.01.2012)
Koordination: Vertr. - Prof. Dr. Nils Zurawski, Institut für Soziologie, Universität Hamburg
20.10.2011 – 26.01.2012 (5 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Happy Meals und Vater Staat (Podiumsdiskussion, 29.03.2012)
Teilnehmer: Andrea Fischer, Bundesministerin für Gesundheit / Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer / Thomas Schramme, Professur für Philosophie, Universität Hamburg
Moderation: Jürgen Kaube (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
29.03.2012 (1 Aufzeichnung)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Carl Friedrich von Weizsäcker-Vorlesungen – 2011 (Vorlesung, 28.11.2011 – 01.12.2011)
Vortragender: Prof. Gerard't Hooft
28.11.2011 – 01.12.2011 (4 Aufzeichnung)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
SIRA/Surveillance Studies Lecture (Vortrag, 11.11.2011)
Vortragender: Prof. Dr. Clive Norris
11.11.2011 (1 Aufzeichnung)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Quand les enfants écrivent les génocides: théories textes témoignages (Vorlesung, 19.01.2012 – 21.01.2012)
Koordination: Prof. Dr. Silke Segler-Meßner, Institut für Romanistik, Universität Hamburg / Prof. Dr. Isabella von Treskow, Institut für Romanistik, Universität Regensburg
19.01.2012 – 21.01.2012 (13 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2011
Exil und Exilforschung: Aspekte ihrer Aktualität (Lesungen, 28.06.2011)
Lesungen: Ursula Krechel, Aris Fioretos
Moderation: Doerte Bischoff, Institut für Germanistik, Universität Hamburg
28.06.2011 (3 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Individualität, Philosophische Perspektiven (Vorlesung,13.04.2011 – 22.06.2011)
Koordination: Dr. Martin Hoffmann, Philosophisches Seminar, Universität Hamburg
13.04.2011 – 22.06.2011 (5 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Das Andere Kommunizieren: Medien und Kulturkontakt in der außereuropäischen Geschichte (Ringvorlesung, 06.04.2011 – 13.07.2011)
Koordination: Astrid Windus / Ulrich Mücke; beide Historisches Seminar, Universität Hamburg
06.04.2011 – 13.07.2011 (7 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Medienkompetenz (Ringvorlesung, 09.06.2011)
Koordination: Jan Claussen
09.06.2011 (1 Aufzeichnung)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2010/11
Alte Geschichte: Segobriga, caput Celtiberiae – eine antike Stadt im Podcast I/II (Hauptseminar, 25.11.2010 – 09.12.2010)
Koordination: PD Dr. Sabine Panzram, Historisches Seminar, Universität Hamburg
25.11.2010 – 09.12.2010 (12 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Fremde Welten – Wege und Räume der Fantastik im 21. Jhd. (Konferenz, mehrtägig, 30.09.2010 – 03.10.2010)
Koordination: Lars Schmeink, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Hamburg
Hinweis: Diese mehrtägige Konferenz wurde in mehreren Serie auf Lecture2Go aufgezeichnet.
- Fremde Welten (1) – Wege und Räume der Fantastik im 21. Jhd. – 30.09.2010 - 03.10.2010 (20 Aufzeichnungen)
-
Fremde Welten (2) – Wege und Räume der Fantastik im 21. Jhd. – 01.10.2010 - 02.10.2010 (19 Aufzeichnungen)
-
Fremde Welten (3) – Wege und Räume der Fantastik im 21. Jhd. – 01.10.2010 - 03.10.2010 (21 Aufzeichnungen)
-
Fremde Welten (4) – Wege und Räume der Fantastik im 21. Jhd. – 01.10.2010 - 03.10.2010 (16 Aufzeichnungen)
-
Fremde Welten (5) – Wege und Räume der Fantastik im 21. Jhd. – 01.10.2010 - 02.10.2010 (14 Aufzeichnungen)
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2010
Carl Friedrich von Weizsäcker-Vorlesungen – 2010 (Vorlesung,21.06.2010 – 23.06.2010)
Vortragender: Prof. John D. Norton
21.06.2010 – 23.06.2010 (3 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Verletzlichkeit (Ringvorlesung, 15.04.2010 – 30.06.2010)
Koordination: Prof. Dr. Thomas Schramme, Philosophisches Seminar, Universität Hamburg
15.04.2010 – 30.06.2010 (4 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Medizinethik (Vorlesung, 06.04.2010 – 06.07.2010)
Koordination: Prof. Dr. Thomas Schramme, Philosophisches Seminar, Universität Hamburg
06.04.2010 – 06.07.2010 (10 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Performing Politics – Internationale Sommerakademie (Konferenz, mehrtägig, 18.08.2010 – 28.08.2010)
Verantwortlich: Prof. Dr. Nikolaus Müller-Schöll, Institut für Germanistik, Universität Hamburg / Matthias v. Hartz, Kampnagel Hamburg
18.08.2010 – 28.08.2010 (11 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Mehrsprachige Kommunikation in Institutionen (Vortrag, 22.06.2010)
Koordination: Julian Fietkau
22.06.2010 (1 Aufzeichnung)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Ethnographischer Film
Koordination: Felix Haupts, Markus Belde, Milagros Vera Coa
Hinweis: Diesen Film finden Sie aufgezeichnet auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen WiSe 2009/10
Einführung in die Narratologie (Vorlesung, 08.12.2009 – 02.02.2010)
Koordination: Prof. Dr. Dr. h. c. Wolf Schmid, Institut für Slavistik, Universität Hamburg
08.12.2009 – 02.02.2010 (7 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Hamburgische Dramaturgien (Vorlesung, 21.10.2009 – 03.02.2010)
Koordination: Prof. Dr. Nikolaus Müller-Schöll
21.10.2009 – 03.02.2010 (13 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
James Bond: die Anatomie eines Mythos (Vorlesung, 05.11.2009 – 21.01.2010)
05.11.2009 – 21.01.2010 (5 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.
Vorlesungsaufzeichnungen SoSe 2009
Poetik der Oberfläche. Die deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre (Vorlesung, 06.04.2009 – 13.7.2009)
Koordination: Olaf Grabienski / Till Huber, Westfälische Wilhelms-Universität Münster / Jan-Noël Thon, Institut für Medienwissenschaft, Universität Tübingen
06.04.2009 – 13.7.2009 (13 Aufzeichnungen)
Hinweis: Diese Veranstaltung finden Sie aufgezeichnet als Serie auf Lecture2Go.